#Politisch-medialer Komplex
Text
Für die NATO auf Konfrontation mit den Bürgern – Antirussische Hysterie und Transatlantizismus
Hybride Bedrohung, Informationskrieg, russische Propaganda: Das sind die Schlagworte, in die deutsche Medien und Politik ihren Kampf gegen die Meinungsfreiheit kleiden. Verhindert werden soll vor allem eine Diskussion über das transatlantische Bündnis.
Das Festhalten am transatlantischen Bündnis geht immer stärker mit umfassenden Wohlstandsverlusten einher und wird sich daher nur gegen den…

View On WordPress
0 notes
Text
Orientierungslose Medien: wenn Kommunalwahlen zu Weltereignissen werden
Tichy:»Mit dem Verlust der Realität steigern sich die Zustände von Fieberdelirien, in die der politisch-mediale-kulturelle Komplex sich in immer kürzeren Intervallen hineinsteigert. Am Anfang des Jahres um den Protest der Bauern aus den Medien und aus der Öffentlichkeit zu drängen, wurde von einem Propagandaportal, das auch von Steuergeldern finanziert wird, eine Räuberpistole über eine staatgefährdende
Der Beitrag Orientierungslose Medien: wenn Kommunalwahlen zu Weltereignissen werden erschien zuerst auf Tichys Einblick. http://dlvr.it/T7S0Zv «
0 notes
Text
How to Dank Images – Methoden der Bildanalyse im Kontext des visuellen Kontrollverlusts
Das Worklab HOW TO DANK IMAGES schließt an das Worklab ‘Dank Images, Tiktok und Apokalypse. Bildhandeln im Internet’ an und extrapoliert die in 2021 identifizierten Diskurse und Leerstellen, die auf ein komplex(er)es Verständnis gegenwärtiger politischer, sozialer und medialer Kommunikation zielen. Ausgehend von der Annahme, dass neuartigen Bildphänomenen Raum gegeben werden muss, unternimmt das Worklab eine methodische Sondierung und Sammlung von Praktiken des Forschens. Denn gerade (Online-)Bilder kommunizieren über unzählige Formen des Alltäglichen und kommentieren politische und gesellschaftliche Ereignisse in Echtzeit. Insbesondere Krisenszenarien befeuern dabei die Bildproduktion und lassen z. B. Memes zu politischen Akteur*innen werden, die besondere Aufmerksamkeit in der Analyse und Diskussion erfahren, und angepasste Methoden erfordern.
Das Worklab fand am 27.&28.10.2023 online statt und näherte sich dem Forschungsthema experimentell über verschiedene offene Austauschformate, partizipative Explorationsräume, sowie Kurzinputs der Teilnehmenden.
WEB: http://kunst.uni-koeln.de/dankimages
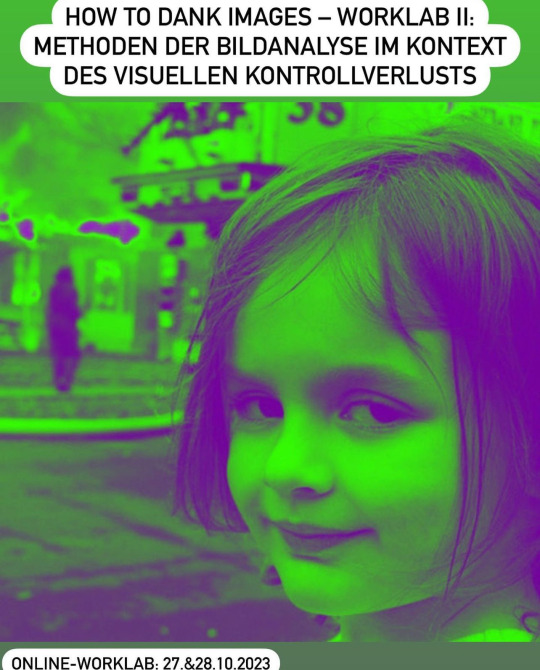

#kunstpaedagogik#mozarteum#arteducation#jangruenwald#jangrünwald#kunstuniköln#zoom#dankimages#medien
0 notes
Text
⚠️ Aktuell werden im griechischen Handelshafen Alexandroupolis hunderte gepanzerte Fahrzeuge und Panzer umgeladen, um sie in osteuropäische NATO-Staaten zu transportieren. Eisenbahnmitarbeiter wollen dies nicht unterstützen und werden nun von den Arbeitgebern unter Druck gesetzt. ↗️ https://www.anonymousnews.org/international/griechenland-eisenbahn-blockade-nato-panzer/
0 notes
Text
Komplexe Bilder

https://www.rexbern.ch/programmreihe/kunst-und-film-komplexe-bilder/
DE
Die von Maia Gusberti in Kooperation mit dem Kino REX kuratierte Reihe präsentiert ab März künstlerische Reflektionen zur De/Konstruktion von Bild und Welt.
Das Programm Komplexe Bilder umfasst Filme von Künstler*innen, die das Bild und die fotografische Abbildung zum zentralen Thema machen, Bilder zu Protagonisten und Akteuren erklären und dabei die Involviertheit von Bild-Produzent*innen, Publikum und Abgebildeten befragen. Die ausgewählten Filme sind künstlerische Reflektionen, die mittels Bildern über Bilder nachdenken: experimentelle, konzeptuelle, ernsthafte und rebellische Beispiele dafür, wie Wirklichkeit repräsentiert, ästhetisch aufbereitet und politisch konstruiert wird und welche Rolle Bilder dabei einnehmen.
Die Arbeiten zeichnen sich durch ungewöhnliche, formal präzise Erzählformen zwischen experimentellem Kunstfilm und essayistisch-dokumentarischen Formaten aus und suchen nach Alternativen zu gängigen Bildsprachen. Es sind filmische Arbeiten, die in Erinnerung rufen, dass jedes Bild immer nur eine Interpretation der Wirklichkeit ist, und die untersuchen, wie unsere Wahrnehmung durch Bilder beeinflusst und manipuliert wird – es sind künstlerische Werke, die Stellung zu einer Ethik des Bildermachens beziehen.
Komplexe Bilder präsentiert Filmkunst, die aufzeigt, dass auch das Ausgesparte, das nicht Abbildbare, das Erahnte oder das jenseits des Bildrahmens liegende Beachtung einfordert, Bilder erzeugt und hervorruft. Die Filme reflektieren über Sehgewohnheiten, das kritische Lesen von Bildern, über technische und gesellschaftliche Voraussetzungen, über Verfügbarkeit und eingeschriebene Codes. In ihren Arbeiten appellieren die Künstler*innen, über die Ränder und Rahmen der Bilder hinauszudenken, verschiedene Bedeutungsebenen zu prüfen, Bilder auf ihren Wahrheitsanspruch zu befragen und politisch aufgeladene Bilder kritisch zu dekodieren. Auf konzeptueller, erzählerischer, formaler und poetischer Ebene wird über Fotografie und Repräsentation nachgedacht. Zugang, Zirkulation, Schärfe und Unschärfe, Auflösung und Verdichtung sowie die Rolle der Medien werden thematisiert und damit Strategien der Kunst und der poetischen Erzählung als subtile, subversive Formen der Kritik untersucht.
Komplexe Bilder beinhaltet vielseitige Beispiele dafür, was stereotypen Erzählungen, medial orchestrierten Bildern und politisch konstruierten Erzählungen entgegenstellt werden kann. Die Filmreihe fordert uns als Bildkonsument*innen und Bildproduzent*innen dazu auf, Bilder nach ihrer Entstehung, Absicht und Wirkung kritisch zu befragen.
FR
Komplexe Bilder (Images Complexes) est un programme de cinéma, accompagnés des discussions, proposé par Maia Gusberti et qui présente des réflexions artistiques sur la dé/construction de l'image et de notre image du monde.
Le programme Komplexe Bilder comprend les films d’artistes qui font de l’image et de la représentation photographique leur thème central, qui expliquent les images en tant que protagonistes and activateurs, et qui questionnent l’engagement du producteur d’image, de l’audience, de ce qui est représenté. Les films sélectionnés sont des réflexions artistiques qui utilisent les images pour penser les images, et qui réfléchissent aux images: des exemples expérimentaux, conceptuels, sérieux et rebelles de comment la réalité est représentée, comment elle est traitée esthétiquement et politiquement construite, et quel rôles les images y jouent.
Les travaux sont caractérisés par des narrations inhabituelles et formellement précises, entre les formats du film d’art expérimental et l’essai documentaire, et cherchent des alternatives au langage visuel commun. Ce sont des travaux cinématographiques qui rappellent que chaque image n’est toujours qu’une interprétation de la réalité, et qui explorent comment notre perception est influencée et manipulée par les images. Il s’agit de travaux artistiques qui prennent position sur l’éthique de la fabrication des images.
Komplexe Bilder présente un art cinématographique qui montre que même l'omis, l'inexprimable, le pressenti ou l'attention au-delà du cadre des images exige, crée et évoque des images. Les films réfléchissent sur les habitudes de visionnage, la lecture critique des images, les prérequis techniques et sociaux, la disponibilité et les codes inscrits. Dans leurs travaux, les artistes invitent le spectateur à penser au-delà des frontières et des cadres des images, à examiner différents niveaux de signification, à remettre en question les images pour leur revendication de vérité et à décoder de manière critique des images politiquement chargées. Sur le plan conceptuel, narratif, formel et poétique, la photographie et la représentation sont considérées. L'accès, la circulation, la netteté et le flou, la dissolution et la condensation ainsi que le rôle des médias seront abordés et les stratégies de l'art et du récit poétique comme formes subtiles et subversives de la critique seront examinées.
Komplexe Bilder comprend une variété d'exemples de ce qui peut être opposé aux récits stéréotypés, aux images médiatiquement orchestrées et aux récits construits par la politique. La série de films nous met au défi, en tant que consommateurs et producteurs d'images, de remettre en question de manière critique l'origine, l'intention et l'effet des images.
Programme
Kino REX, Berne
Di. 5 mars 18:30
Programme 1: Image/Médias/Violence
Introduction par Maia Gusberti, suivie d'une discussion avec Rachel Mader (Université des Beaux-Arts & Design, Lucerne) et Maren Polte (Haute école des arts de Berne) et le public.
Prochaines dates: 2 avril, 7 mai et 4 juin 2019.
EN
Komplexe Bilder (Complex images) is a film programme proposed by Maia Gusberti, and accompanied by discussions, that presents artistic reflections on the de/construction of images and of our vision of the world.
The Komplexe Bilder programme comprises films by artists who make the image and photographic depiction the central theme, explain images as protagonists and activators, and question the involvement of the image producer, the audience and the depicted. The selected films are artistic reflections that use images to think about images, and to reflect on images: experimental, conceptual, serious and rebellious examples of how reality is represented, aesthetically processed and politically constructed, and what role images play in it.
The works are characterized by unusual, formally precise narrations between experimental art film and essayistic-documentary formats and search for alternatives to common visual languages. They are cinematic works that recall that each image is always only an interpretation of reality, and that investigate how our perception is influenced and manipulated by images - they are artistic works that take a stand on the ethics of making images.
Komplexe Bilder presents film art that shows that even the omitted, the unrepresentable, the presaged, or the attention beyond the pictures frame demands, creates and evokes images. The films reflect on viewing habits, the critical reading of images, on technical and social prerequisites, on availability and inscribed codes. In their works, the artists appeal to the viewer to think beyond the borders and frames of the images, to examine different levels of meaning, to question images for their claim to truth, and to critically decode politically charged images. On a conceptual, narrative, formal and poetic level, photography and representation are considered. Access, circulation, sharpness and blurriness, dissolution and condensation as well as the role of the media will be addressed and strategies of art and poetic narrative as subtle, subversive forms of critique will be examined.
Komplexe Bilder contains a variety of examples of what can be opposed to stereotypical narratives, medially orchestrated images and politically constructed narratives. The film series challenges us as image consumers and image producers to critically question images with regard to their origin, intention and effect.
Programme
Kino REX, Bern
Su 5 March 18:30
Programme 1: Image/Media/Violence
Introduction by Maia Gusberti, followed by a discussion with Rachel Mader (Lucerne School of Art and Design) and Maren Polte (Bern University of the Arts) and the audience.
Next programmes: 2 April, 7 May and 4 June 2019.
#maia gusberti#method to my madness#searcher in digital space#flare#magazine#photoforumpasquart#biel#bienne#de#fr#en#komplexe bilder#complex images#images complexes#kinoprogramm#programme cinema#cinema programme
0 notes
Text
Groteske Stilblüten der Anti-Trump-Presse: Mediale Milde für unmenschliche Mörder?
Neuer Beitrag veröffentlicht bei https://melby.de/groteske-stilblueten-der-anti-trump-presse-mediale-milde-fuer-unmenschliche-moerder/
Groteske Stilblüten der Anti-Trump-Presse: Mediale Milde für unmenschliche Mörder?


© Shutterstock
Mitte Mai frohlockten die Trump-Hasser in den Redaktionsstuben. Die Meldung verbreitete sich in Windeseile: Der US-Präsident habe Einwanderer als „Tiere“ bezeichnet – Entmenschlichung von Schutzsuchenden, von Menschen, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben in die USA wollen. Das saß, der Rassist im Weißen Haus hatte scheinbar wieder einmal seine hässliche Fratze gezeigt.
Halt! Stopp!
Ganz so hatte es sich nicht zugetragen. Die ganze Angelegenheit war doch etwas komplexer, als es auch Medien hierzulande zunächst vermeldet hatten. Denn die Aussage von Trump, jene Menschen seien schlimmer als Tiere, war nicht auf alle Personen bezogen, die in die Vereinigten Staaten einwandern wollen.
Doch zunächst das Trump-Zitat, dass den Sturm im Wasserglas auslöste: „You wouldn`t believe how bad these people are. These aren`t people. These are animals. And we`re taking them out of the country at a level and at a rate that´s never happened before.“ Aber ging e shier wirklich um Einwanderer?
Auch in diesem Fall gilt wieder die Weisheit: Kontext ist König. So war nämlich in der Berichterstattung die nicht unbedeutende Tatsache ausgeklammert worden, dass sich Trumps Aussage auf ganz spezielle Einwanderer bezog, und zwar auf die Mitglieder der Verbrecherbande MS-13. Um zu zeigen, um welche Klientel es sich dabei handelt, sind einige Informationen über diese Organisation hilfreich.
„Mata, viola, controla“
Das Ursprungsland von Mara Salvatrucha, wie die Gang in der Langform heißt, ist El Salvador. Von dort aus expandierte sie und verfügt schätzungsweise derzeit über 50.000 bis 100.000 Mitglieder in Nord- und Südamerika. Das Tätigkeitsgebiet der Kriminellen umfasst den Waffen-, Menschen- und Drogenhandel, Prostitution, Diebstahl und Schutzgelderpressung. Besonderes Merkmal von MS-13 ist ihre abscheuliche Brutalität, mit der sie ihre Interessen durchsetzt. So werden Opfer häufig bestialisch verstümmelt und ihre Leichen zum Teil an öffentlichen Plätzen abgelegt. Wie Kriminal-Experten berichten, werden nur Mörder in die Bande aufgenommen, getreu dem Grundsatz: Blood in, blood out. So kann auch der Austritt nur durch den Tod erfolgen. Wahlspruch von MS-13 ist „mata, viola, controla“, also „töten, vergewaltigen, kontrollieren“.
Wer nur einen Ausschnitt der Berichte aus US-Medien über die Taten dieser Bande liest, kann die Abscheu verstehen, mit der Trump über diese Personen urteilte und ihnen die Menschlichkeit absprach. Doch um dem Präsidenten wieder Rassismus vorzuwerfen, gaben sich politische Kommentatoren und auch US-Demokraten dafür her, auch noch MS-13 Mitglieder vor Trump in Schutz zu nehmen.
Chuck Schumer – der demokratische Senator sei an dieser Stelle stellvertretend zitiert – empörte sich über Trumps Aussage mit dem Hinweis darauf, dass die Vorfahren der heutigen US-Amerikaner als Einwanderer in das Land kamen. Auf Twitter schrieb Schumer: „When all of our great-great-grandparents came to America they weren`t ‚animals‘ and these people aren`t either.“ Pro-republikanische Kommentaren fragten süffisant, ob denn der Familienstammbaum von Schumer Drogendealer, Vergewaltiger und Mörder aufweise?
Verzerrte Wahrnehmung statt null Toleranz
Als sich allmählich verbreitete, dass Trump eben jene Verbrecher der MS-13 meinte, begann das schwerfällige und widerwillige Zurückrudern. Zu schön las sich doch die Meldung von der vermeintlichen verbalen Total-Entgleisung des US-Präsidenten. Selbst dann waren sich manche Trump-Hasser nicht zu schade, die Menschlichkeit von MS-13 Mitgliedern zu betonen. Der konservative Journalist Paul Joseph Watson brachte es auf den Punkt: Angesichts einer derart verzerrten Wahrnehmung und des grotesken Hasses auf den Präsidenten sind dessen Gegner das Problem.
Man kann viel über Trumps Politik und seine Maßnahmen streiten. Aber der Plan, MS-13 mit einer null Toleranz Politik zu bekämpfen und ihre Mitglieder außer Landes zu schaffen, kann nur uneingeschränkt begrüßt werden. An seiner Titulierung ihrer Mitglieder als „Tiere“ ließe sich höchstens kritisieren, dass er damit die Tierwelt beleidigt.
von Alexander Graf
The European – Neuste Beitraege
Alexander Graf
Quelle
قالب وردپرس
0 notes
Text
Die Macht und ihre Ikonen
Großartiges Rüstzeug für die Bilderstürme des 21. Jahrhunderts: ein Handbuch der politischen Ikonografie aus der Warburg-Schule
(Rezension aus 2012 betr.: Uwe Fleckner, Martin Warnke, Hendrik Ziegler [Hg.]: Handbuch der politischen Ikonographie. 2 Bde. München: Beck 2011, 1137 S. u. 1336 Abb.)
Die sogenannten "Medien" der, sagen wir, letzten 100 Jahre legen zumindest drei Befunde nahe. Da wäre zum einen die Feststellung, dass es sich bei diesen Hervorbringungen um angewandte Kulturtechniken handelt. Daran ließe sich anschließen, dass diese Medien keine Einzelerscheinungen sind, sondern sich zu politisch-ökonomisch nutzbaren und folglich auch genutzten Medienverbünden fügen. Schließlich könnte man darauf abstellen, dass das Bild, ungeachtet mancher Rufe nach " Heiligen Texten" und der Ehrfurcht vor binär codierten Kommandozeilen, einen besser nicht zu unterschätzenden Stellenwert hat.
Dem hier anzuzeigenden Handbuch der politischen Ikonographie geht es jedoch nicht so sehr um eine triviale Parallelschaltung derartiger " Erkenntnisse", sondern vielmehr um eine gezielte Zusammenführung. Dann ließen sich wohl auch die hierzulande hinsichtlich ihres Anspruchs forciert bescheiden geführten Debatten über die Abbildungsstrategien in Wahlkämpfen und bei Insertionen spannender gestalten. Bisher handelt es sich meist um Rundumschläge für alle, Ikonoklasmus für jeden, Reflexion für niemanden. Zu ergründen, warum dem so ist, muss an die Spekulation abgetreten werden (etwa: habsburgisch geprägte Bilderlust barock-katholischen Zuschnitts mit hegemonialem Mehrwert). Oder man macht sich lieber selbst ein Bild.
Komplexe Analyse
Jemand, der sich dieser Aufgabe verschrieben hatte, war Aby Warburg (1866-1929) - "Amburghese di cuore, ebreo di sangue, d'anima Fiorentino" -, Kunsthistoriker und wohl auch, mit seiner durchaus komplex zu nennenden ikonologischen Beobachtungs- und Analysemethode, Mitbegründer einer heute (ungeachtet aller Irrläufer) mit "Kulturwissenschaft" umreißbaren Ausrichtung des akademischen Betriebs. Bei seinem Tod hinterließ er nicht nur die von ihm begründete Kulturwissenschaftliche Bibliothek in Hamburg - ganz wesentlich hatte er eine ganze Denkschule geprägt und mit dieser die Bedeutung der Ikonologie etabliert.
Ausgehend von Forschungen zum Nachleben der Antike in der Renaissance war es ihm gelungen, aufzuzeigen, wie sehr Bildinhalte nicht nur ein Eigenleben über ihre ursprünglich intendierte Bedeutung hinaus entfalten können, sondern auch wie sehr sich die einstigen Darstellungsgehalte mit ihrer je neuen Umgebung zu einem noch einmal neuen, zusätzlichen Bedeutungszusammenhang verschränken. Dieses Nachleben mit seiner spezifischen Aussagekraft ist keineswegs ein auf das Gebiet der Kunst beschränktes Phänomen, vielmehr lassen sich derartige Effekte (und gerade Warburg zeigte dies sehr deutlich) bis in die Bildwelten des Alltags hinein verfolgen, gleichgültig, ob es sich um Werbeeinschaltungen, Briefmarken, Münzen oder Buchumschläge handelt.
Wenn nun mit Martin Warnke und Uwe Fleckner (Dritter im Bunde ist Hendrik Ziegler) zwei angesehene Repräsentanten der Warburg-Schule einen gewichtigen Doppelband herausgeben, den sie der "politischen Ikonographie" verschreiben, dürfen die Erwartungen in mehrfacher Hinsicht hoch angesetzt werden. Tatsächlich erweisen sich die zwei ein klein wenig unscharf als "Handbuch" bezeichneten Bände als inhaltliches Schwergewicht ersten Ranges. Gewiss wird es Leser geben, die mit der Materie politischer Ikonografie sich (in welcher Form und aus welchem Grund auch immer) auseinandersetzen müssen - und die beim Blättern durch und Lesen in den Bänden thematische Lücken finden.
Begriffliche Regie
Sicherlich werden Leser und Leserinnen da oder dort diesen einen ganz bestimmten und notwendigen Hinweis gerade hier nicht finden - und dafür jenen dort zu vermissen sich angehalten sehen. Dennoch ist festzustellen, dass es bislang niemand anderen gab, der sich in der Lage sah, für den deutschsprachigen Raum (aber auch weit darüber hinaus) eine derart stupende Fülle an Überblicken zu organisieren, um die 100 Beiträgerinnen und Beiträger aufzubieten, knapp 150 Stichworte auszuwählen, ein durchaus akribisches Lektorat aufzubieten und schließlich der politischen Wissensproduktion nicht wenig an Neuem aufzugeben.
Von "Abdankung" bis "Huldigung" und von "Imperator" bis "Zwerg" - selbstverständlich hat bei der Aufteilung der Schlagworte die ordnende Hand der Herausgeber begriffliche Regie geführt, denn eine allzu pedantische Aufteilung der knapp 1140 Seiten hätte sonst die Stichworte der beiden Bände von "Abdankung" bis "Karikatur" und "Kleidung" bis " Zwerg" strukturiert. Das wäre natürlich auch in Ordnung gewesen. Aber eben dies nicht zuzulassen und mithilfe der Zuordnung einen zweimaligen ironischen Zusammenhang zu stiften ist dahingehend ein editorischer Fingerzeig, dass man sich der vielfachen Aufgabengebiete eines solchen Handbuchs der politischen Ikonografie durchaus bewusst war. Wobei: "Stichwort" trifft es noch nicht ganz (und würde auch einem enzyklopädischen Missverständnis die Bahn ebnen).
Denn es geht ganz klar um politische Situationen und Themen, wenn etwa vom "Bad in der Menge", der "Begegnung von Herrschern", der "Politischen Landschaft", der "Hand in der Weste" und dem "Politischen Material", dem " Recht am eigenen Bild", den "Zwei Körpern des Königs" oder auch dem "Tod des Herrschers" die Rede ist. "Pflasterstein" und "Exekution", "Leerer Thron" und "Wahl", "Majestätsbeleidigung" und "Damnatio memoriae" - die Zusammenhänge zu erschließen, die Kombinatoriken zu erproben: Hier drängen sich tage-, ja wochenlange Lektüren auf, bietet sich immer wieder neues Nachschlagen und Sehenlernen an. Eine Freude und ein Erkenntnisgewinn sondergleichen - auch wenn die mitunter etwas klein geratenen Abbildungen sich gelegentlich einer allzu raschen Einsichtnahme widersetzen.
Aus nahezu jeder der zahlreichen Begrifflichkeiten lässt sich problemlos ein Österreich-Bezug ableiten. So man dies in der Manier eines Sportreporters möchte ... Einer liegt bereits optisch nahe: So wird die österreichische Bundesministerin für Verkehr und Infrastruktur mit kämpferischer Pose abgebildet, ihr folgen in den bildlichen Verweisen u. a. Margaret Thatcher und Hillary Clinton, dies erfährt in weiterer Folge eine Rückbindung an extrapolierte Herrschaftsgesten insgesamt, an Formen körperlicher Rhetorik in Statuen, auf Briefmarken und Gemälden.
Deutlich wird, wie wesentlich sich spezifisches "gestisches Vokabular" aus zahlreichen Kulturzusammenhängen, Querbezügen und deren Abbildungsverfahren herleitet, welche Mutationen derartige Gemengelagen durchlaufen - und dass je aktuelle Fragestellungen die Überlieferung mit neuen Zusatzbedeutungen anreichern (dies gerade auch dann, wenn das Schlagwort dazu "Politikerin" lautet).
Die mediale Repräsentation ist hier entscheidend, wobei etwas eingelagert ist, das zwar unverbrüchlich als Erbe durch die Zeiten weitergereicht wird, oft jedoch als nicht erklärbar stehen bleibt - und gerade deshalb der Analyse und Erklärung bedarf.
Das "Handbuch" stellt in dieser Aufmachung und mit all seiner inhaltlichen Tiefenschärfe natürlich auch eine eminent politische Ansage dar, versteht man es als Werkzeugkasten für den eigenen Erkenntnisanspruch. Dann wird es zum Vademecum derjenigen, die sich über Bilder im politischen Zusammenhang Aufschluss verschaffen, ihren medientheoretischen Ansatz überprüfen oder einfach nur auf die forcierte Reflexion des zu Sehenden und daraus ableitbare Anwendungen abstellen möchten.
Den Primat der Politik einzufordern ist das eine, das andere ist die Notwendigkeit, sie nicht nur sehen, sondern auch lesen zu lernen. Hier ließe sich der Bogen zurück zu Warburg spannen: Auch sein Gesamtwerk ergibt sich erst aus der Zusammenschau seiner Teile (was trivialer klingt, als es zu bewerkstelligen ist). So wie bei seinen Texten wird auch das vorliegende Handbuch erst in seiner Zusammenschau und Umlegung auf reale Bildverhältnisse vollständig - Anhänger eines positivistischen Überblicks oder poststrukturalistischer Missverständnisse werden damit jedoch ihre Probleme haben müssen.
In unserem bereits vom monarchischen Erbe her mit Bildnissen reichlich und gut ausgerüsteten Land drängt sich eine derartige Kultur des Umgangs mit Bildnissen vielleicht nicht unbedingt auf. Und ob die mehr als 1100 Seiten der beiden Bände, die 141 thematischen Beiträge von etwa 100 Autorinnen und Autoren, die mehr als 1300 Abbildungen daran etwas ändern können, bleibe dahingestellt. Viel bessere Unterstützung wird es absehbar jedoch nicht geben.
[ Rez. v. Peter Plener; in: Der Standard v. 14. April 2012 – Link ]
1 note
·
View note
Photo
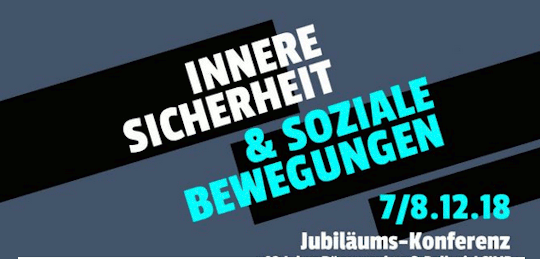
CILIP - 40 Jahre "Bürgerrechte und Polizei"
Innere Sicherheit & soziale Bewegungen
war der Titel der Konferenz zum 40. Jahrestag der Zeitschrift "Bürgerrechte & Polizei / CILIP" in der Humboldt Universität in Berlin. Aktive von Aktion Freiheit statt Angst waren an beiden Tagen dabei und haben einige Vorträge und Diskussionen miterleben können.
Alle Themen drehten sich um den verhängnisvollen Ansatz des Staats, dass "Sicherheit" nur durch immer neue "Sicherheitsgesetze" zu erhalten wäre, ohne dass man sich nach deren Einführung mal um ihre Wirkungen und angeblichen "Erfolge" kümmern müsste. Alle in diese Gesetze auf Drängen von Bürgerrechtlern späteren Evaluierungen wurden von Nachfolgeregierungen übergangen oder marginalisiert.
Das einzige formal zurückgezogene Gesetz bleibt Ursula von der Leyen's Zugangserschwerungsgesetz , die Vorratsdatenspeicherung von 2016, VDS 2.0,gilt als Gesetz, wurde aber von der Bundesnetzagentur "ausgesetzt" (Bundesnetzagentur "verzichtet" auf Vorratsdatenspeicherung).
Die Themen auf dem CILIP Kongress waren:
Freitag, 7. Dezember
19:00 Uhr Keynote-Vorträge (Hörsaal 2097)
Begrüßung und Eröffnung durch das Institut für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit und die Redaktion der CILIP
Einführung, Moderation: Heiner Busch
Keynote I: „Polizei und Bürgerrechte in Zeiten der Sicherheit“
Tobias Singelnstein (Ruhr-Universität Bochum)
Keynote II: „Bürgerrechte in Bewegung: Die Demokratie auf der Straße verteidigen“
Elke Steven (Digitale Gesellschaft e.V.)
Samstag, 8. Dezember
10:00 – 12:00 Uhr 1. Panelphase
Politische Ökonomie der Sicherheit
Helga Cremer-Schäfer, Goethe-Universität Frankfurt
Volker Eick, Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V.
Moderation: Dirk Burczyk, CILIP
Politische Bewegung unter Druck
Angela Furmaniak, Rechtsanwältin
Vertreterin der Hamburger G20-Soligruppe United We Stand
Moderation: Lukas Theune, Rechtsanwalt
Das Europäische Grenzregime - Widerstand gegen diese Festung Europa
Britta Rabe, Watch the Med Alarmphone/ Komitee für Grundrechte und Demokratie
Carsten Gericke, Rechtsanwalt, European Center for Constitutional and Human Rights
Moderation: Matthias Monroy, CILIP
Die Inszenierung des Ausnahmezustands in Hamburg
Peter Ullrich, Technische Universität Berlin
Gruppe „Andere Zustände Ermöglichen“ (AZE)
Marco Heinig, Leftvision
Moderation: Elsa Koester, Journalistin
Polizieren der Armen
Norbert Pütter, CILIP
Lisa Riedner, Georg-August-Universität Göttingen
Moderation: Jenny Künkel, CILIP
Ausnahmezustände und drohende Gefahren (14-15.30 Uhr!)
Fabien Jobard, Centre national de la recherche scientifique
Heiner Busch, CILIP
Moderation: Louisa Zech, Ruhr-Universität Bochum
Racial profiling und institutioneller Rassismus
Ayşe Güleç, Pädagogin und aktivistische Forscherin, (entschuldigt)
NN. Initiative 6. April, Tribunal NSU-Komplex auflösen
Bafta Sarbo, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD Bund)
Moderation: Charlie Kaufhold, Autor*in, promoviert zum NSU
Kontrolle der Polizei
Anna Luczak, Rechtsanwältin
Philipp Krüger, Sprecher der Themenkoordinationsgruppe Polizei & Menschenrechte bei Amnesty International
Moderation: Dirk Burczyk, CILIP
16-18 Uhr 3. Panelphase
NSU-Komplex: Kein Ende der Aufklärung!
Antonia von der Behrens, Rechtsanwältin
Martin Steinhagen, Journalist
Katharina König-Preuss, MdL Thüringen
Moderation: Heike Kleffner, Journalistin
Kämpfe um das Versammlungsrecht
Corinna Genschel, Grundrechtekomitee
Interventionistische Linke
Moderation: Michael Plöse, Humboldt-Universität Berlin
Wissen über die Polizei
Stephanie Schmidt, Polizeiforscherin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt
Moderation: Benjamin Derin, CILIP
Digitale Überwachung
Anna Biselli, Journalistin
André Meister, Netzpolitik.org
Moderation: Matthias Monroy, CILIP
19:00 – 21:00 Uhr: Abschlussdiskussion zu Protest & Sozialen Bewegungen (Hörsaal 2097)
Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V.
Republikanischer Anwältinnen – und Anwälteverein e.V.
Frederick Heussner, Bündnis gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz
Andreas Blechschmidt, Aktivist aus Hamburg
Moderation: Friederike Wegner, CILIP
Wir sind noch dabei unsere Erfahrungen zusammenzutragen und werden demnächst hier über einige Veranstaltungen berichten.
1. Die Inszenierung des Ausnahmezustands in Hamburg
Augenzeugen bei den G20 Protesten konnten feststellen: Was sich schon im Vorfeld abzeichnete, als beispielsweise genehmigte Camps polizeilich geräumt wurden, tauchte in der Rhetorik medialer und polizeilicher Berichterstattung wieder auf: Wir haben es hier mit einem Ausnahmezustand zu tun. So begleiteten Rechtsbeugung, Grundrechtsverletzungen und dreiste Lügen von staatlicher Seite das Gipfelgeschehen und dessen Nachspiel. Dagegen stand von den Protestierenden eine andere Erzählung von Solidarität und Wut, die mit journalistischen, wissenschaftlichen und politisch-praktischen Mitteln geschrieben wird.
Die Hamburger Polizeiführung ist seit Jahren dafür bekannt, dass sie bei der Durchsetzung von ihrem Verständnis von "Recht und Ordnung" nicht zimperlich ist. In den G20-Gipfel ging sie mit dem Anspruch darauf jeden Rechtsverstoß mit "aller Vollständigkeit" zu verhindern. Da dieser Anspruch auch vorher in aller Breite zu den Medien kommuniziert wurde, musste sie bei der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Proteste scheitern.
Auch die technische Aufrüstung mit panzerähnlichen Fahrzeugen auf der einen und technischen Überwachungsmitteln auf der anderen Seite war für sie nicht ohne Komplikationen. So mussten vielfach für die Auffahrt der Panzer erst einmal mit viel Aufwand und Zeit die betroffenen Straßen von parkenden Autos befreit werden.
In jedem Fall war der Polizeieinsatz das Gegenteil dessen, was das BVerfG in seinem Urteil zu den Brokdorf Demos festgelegt hatte:
ein Polizeieinsatz soll verhältnismäßig sein
die Polizei soll versammlungsfreundlich agieren.
Während mit einigen Anmeldern die Kooperationsgespräche ohne oder mit wenigen Problemen liefen, wurden sie anderren einfach verweigert. Erst durch Intervention aus der Politik wurde die Polizeiführung zu den notwendigen Gesprächen gezwungen. Eine Unterteilung von Demo-Anmeldern in "Gute" und "Böse" im Vorfeld steht der Polizei in keinem Fall zu.
Die G20-Demos wirken in ihrer Einschüchterung und im Öffnen von Schranken bis heute fort. Die Änderungen der Polizeigesetze in den einzelnen Bundesländern und das vermehrte Auftreten von "Robocops" und SEK's auch bei kleinen Demos sind die sichtbare Folge.
...
2. Racial profiling und institutioneller Rassismus
Vor allem schwarze Menschen aber auch Menschen aus anderen Erdteilen erleben in Deutschland oft Rassismus, teilweise "zwischen den Zeilen" aber auch oft direkt und verletzend. So ist Rassismus auch zentral für die Entscheidung, bei wem die Polizei sogenannte verdachtsunabhängigen Personenkontrollen durchführt.
Rassismus war auch bei den polizeilichen Ermittlungen im NSU-Komplex von zentraler Bedeutung. Obwohl die Überlebenden des NSU die rassistischen Hintergründe der Taten unmittelbar richtig analysierten, schlossen die Polizeien ein rechtes Tatmotiv fast durchgängig aus.
So wurden in dieser Diskussion genau diese beiden völlig verschiedenen Ebenen, einmal die staatlich verordnete und zum anderen die dumpf faschistische, untersucht und versucht ihre historische Herkunft bei den Handelnden zu entlarven.
...
Mehr dazu bei https://www.cilip.de/2018/10/12/konferenz-40-jahre-cilip/
und https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/6717-20181209-cilip-40-jahre-buergerrechte-und-polizei.htm
#RacialProfiling#Polizei#CILIP#Kongress#40Jahre#Überwachung#Unschuldsvermutung#Vorratsdatenspeicherung#Rasterfahndung
0 notes
Text
Eurozonenbudget:
[su_heading size=”18″]Ein neues Versailles[/su_heading]
Die Forderung von Frankreichs Präsident Macron nach einem gemeinsamen Haushalt für alle Staaten der Eurozone wird wahr. Olaf Scholz (SPD) knickt ein. Der politisch-mediale Komplex applaudiert. Zahlmeister: Deutschland.
(more…)
View On WordPress
#Banditen#CDU Schergen#CSU Heuchler#Deutschland#Europa#Grüne Päderasten#Plünderung#Politische Verwahrlosung#Raub#Scholz#SPD Dümmlinge#Versailles#Zahlmeister
0 notes
Photo

Liebe Leser, in seiner Verzweiflung ob der mittlerweile allerorten in Deutschland zu beobachtenden, negativen Entwicklungen versucht der politisch-mediale Komplex dieses Landes bekanntlich immer wieder, uns zu unterstellen, wir verbreiteten Fake News. Das tun wir mitnichten. Wir berichten lediglich die Fakten und haben den Anspruch, dass sich die Bürger auf unsere Aussagen verlassen können. Sollte dies im absoluten Einzelfall misslingen, sind wir selbst einer veröffentlichten Falschmeldung aufgesessen. Es scheint nun so, als seien Millionen und Abermillionen von Wählern bei der letzten Bundestagswahl vor fast genau einem Jahr einer sehr dreisten Falschmeldung aufgesessen. Nämlich einer Aussage jener unsäglichen Dame im Kanzleramt. Sie hatte in der Frühphase des sich abzeichnenden, intensiven Wahlkampfs nämlich die folgende Beruhigungspille für die Bürger ausgegeben: Es könnten nur jene bleiben, die wirklich verfolgt sind, daher stehe nun "Rückführung, Rückführung und nochmals Rückführung" abgelehnter Asylbewerber auf der Tagesordnung. Hier nachzulesen: https://www.welt.de/politik/deutschland/article157927543/Rueckfuehrung-Rueckfuehrung-und-nochmals-Rueckfuehrung.html Tatsächlich fanden in den Jahren 2016 und 2017 gerade einmal lachhafte ca. 25.000 Rückführungen pro Jahr statt, und niemand weiß, wie viele von den Rückgeführten sofort per Drehtüreffekt über die offene Grenze wieder in unser Land hineingemerkelt sind. Die aktuellen Werte für das Jahr 2018 deuten sogar einen Rückgang dieser ohnehin schon viel zu geringen Werte an. 25.000 Rückführungen, das ist wie der berühmte Tropfen auf den heißen Stein in Anbetracht des millionenfachen Zustroms, der auf Merkels Einladung hin einsetzte. Zeit für unsere AfD💙 #stuttgart #karlsruhe #mannheim #freiburg #heidelberg #afd #afdesslingen #ulm #heilbronn #pforzheim #reutlingen #ludwigsburg #esslingen #esslingenamneckar #tübingen #villingenschwenningen #konstanz #aalen #sindelfingen #schwäbischgmünd #friedrichshafen #offenburg #göppingen #waiblingen #badenbaden #ravensburg #lörrach #böblingen #filderstadt #fellbach (hier: Esslingen) https://www.instagram.com/p/BoJdFpCAPBH/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1lsbvo2kstvit
#stuttgart#karlsruhe#mannheim#freiburg#heidelberg#afd#afdesslingen#ulm#heilbronn#pforzheim#reutlingen#ludwigsburg#esslingen#esslingenamneckar#tübingen#villingenschwenningen#konstanz#aalen#sindelfingen#schwäbischgmünd#friedrichshafen#offenburg#göppingen#waiblingen#badenbaden#ravensburg#lörrach#böblingen#filderstadt#fellbach
0 notes
Text
Es wird immer irrer: Krah-Mitarbeiter wohl Informant des sächsischen Verfassungsschutzes
Ansage: »Während der politisch-mediale Komplex mit der vermeintlichen Spionage-Affäre um Maximilian Krah den nächsten Schlag gegen die AfD zelebriert, verdichten sich die Hinweise darauf, dass Jian Gao, Krahs Mitarbeiter, der diese Woche wegen des Verdachts auf Spionage für China verhaftet wurde, auch Informant des sächsischen Verfassungsschutzes war. Demnach soll die Behörde Gao erstmals 2007 angesprochen haben, nachdem […]
The post Es wird immer irrer: Krah-Mitarbeiter wohl Informant des sächsischen Verfassungsschutzes first appeared on Ansage. http://dlvr.it/T64xp0 «
0 notes
Photo

Die größten Kritiker der Elche...
Prolog
Von vielen Geweih/Horntieren ist bekannt, dass sie, wenn in Gefahr, sehr schnell flüchten und sehr hoch springen. Ob Hirsch oder Antilope, Springboek oder Elch, da sind sie sich ziemlich ähnlich. Von vielen Hochhäusern oder Strommasten ist bekannt, dass sie hoch sind, und im Luftraum im Weg stehen.
Wenn jetzt ein Pilot in das Hochhaus kracht, bringt dann das Hochhaus den Hubschrauber zum Absturz? Oder machte der Pilot einen Fehler, der zum Absturz führt?
Mir ist natürlich der Zusammenhang zwischen knackiger Schlagzeile, Auflagen- und Klickzahlen und Werbeeinnahmen bewusst, dennoch kann man hier durchaus von einer Täter-Opfer Umkehr sprechen (sprachlich durch eine Subjekt-Objektumkehr). Denn hier wurde ein in Panik fliehendes Tier durch einen Pilotenfehler getötet und dazu noch der Hubschrauber zerstört.
Aber eigentlich geht es hier gar nicht um Elche, sondern es soll die Frage einiger meiner (wenigen) Leser beantwortet werden, weshalb ich soviel zum Thema Israel rante und schimpfe.
Also: Pourquoi Israel?
Ganz allgemein ist Israel weder besser oder schlechter als die meisten kapitalistischen, demokratischen Nationalstaaten. Die meist auf der nordwestlichen Hemisphäre des Planeten liegen und auch nicht "Die Guten" sind, aber wie Gremliza es irgendwo mal schrieb, "den geopolitischen Alternativen" meist vorzuziehen seien. Und im Handeln, wie hätte man früher gesagt, des militärisch-industriellen Komplexes kapitalistischer Nationalstaaten nach Liebe und Harmonie zu suchen, ist der falscheste (man verzeihe mir den krummen Superlativ) Ansatz der Welt.
Es gibt politisch zweifelhafte und gänzliche Fehlentscheidungen und Versäumnisse, (und ja man darf/muss dikutieren ob der sogenannte "Siedlungsbau" in einem bestimmten Moment in einem bestimmten Gebiet gerade Sinn macht, ob es strategische Altenativen zum Umgang mit Gaza, der Hamas etc. gibt). Man darf die militärischen Entscheidungen und Handlungen anzweifeln und benennen. Man darf von Korruption und religiösen Wahn berichten. Und darf davon berichten, wenn politisches Machtkalkül stärker als die Vernunft ist.
Aber was man nicht darf, ist durch Verknüpfung mit antisemitischen Topoi, durch Auslassung und Verzerrung, durch Unterstellung und einseitige Fixierung, man könnte sagen durch Prinzipien der eristischen Dialektik (Schopenhauer) eine singuläre Einseitigkeit in der Berichterstattung entstehen zu lassen.
Natürlich ist mir die Politik der Israelis nicht egal, und ich sehe politische Aussagen und Entscheidungen dort genauso kritisch, wie ich die Entscheidungen und Aussagen der vielen bayerischen Ministerpräsidenten die ich erlebt habe, zum kotzen finde. Wenn Netanjahu (ein religiös nationalistischer Rechter) mein Ministerpräsident wäre, würde ich genauso kotzen wie unter Strauß und Stoiber (ff), aber... Aber, erinnert sich noch jemand an die 17 jährige Schulsprecherin Christine Schanderl, der im Wahlkampf 1980 wegen eines "Stoppt Strauß" Buttons der Prozess gemacht wurde? (Die hat nicht mal Soldaten gebissen.) Erinnert sich noch jemand wie der Herr Mapus, Demonstranten die gegen einen Bahnhof waren, mit Wasserwerfen die Augen aus den Höhlen trieb? Erinnert sich noch jemand an die Korruptionsaffären der CDU, die Gemengelage zwischen Bauämtern und Baufirmen, die Mafia in Europa, die Kollateralschäden am Hindukusch, die Verstrickungen des Staates in nationalistische, rassistische Attentate von Oktoberfest bis NSU? Ähnliches gibt es in Israel auch.
Und genauso wie hier versucht der (lautere) Teil des Rechtsstaat das gerichtlich aufzuarbeiten. Ist ein Politiker korrupt, kommt es hie wie da zu einem Prozess und manchmal wird, hie wie da, auch einer verurteilt.
Wenn ein Soldat oder Polizist sich unrechtmäßig oder grausam verhält, dito.
Dass die Urteile nicht immer gerecht sind liegt am System (s.o.) und an den Menschen. Der Rechtsstaat unterscheidet sich von den Unrechtsstaaten nicht dadurch, dass im ersteren alle lieb, fair, ehrlich etc. sind, sondern, dass a) die Betreffenden im allgemeinen zur Rechenschaft gezogen werden und b) bis zum Urteil die Unschuldsvermutung gilt. Darf man darüber Berichten, dass Netanjahu der Prozess droht, oder Katsav wegen sexueller Übergriffe veruteilt wurde?
Darf man über den Schusswaffeneinsatz eines Soldaten, der deswegen vor Gericht landete berichten? Man muss sogar.
Wenn aber gleichzeitig über die Nichtrechtstaatlichkeit der umgebenden Nationen (inkl. Palästinenser), über Korruption, Lynchjustiz, Kindersoldaten etc. nicht einmal im annähernden Umfang (meist eben gar nicht) berichtet wird, kriegt die Berichterstattung eine Schieflage. (Über nichtstattfindende Gerichtsverhandlungen kann man ja nicht schreiben).
Schräg wird´s dann, wenn Israel, aufgrund seiner reinen Existenz und seiner Sicherheitsvorkehrungen, auch noch dafür verantwortlich gemacht wird.
Es kippt, wenn man (speziell bei deutschen Medien & Politikern, aber die anderen EU Staaten sind nicht viel besser) von Israel fordert in solchen Situationen aufgrund des Holocaust moralischer zu handeln, als man es selbst je tat und täte. Und in dem Kontext gar unserere besonderen Verantwortung, israelkritisch zu sein, betont. Und endgültig in die braune Scheiße fällt es, wenn Anspielungen auf Rachsucht, Gier und Geilheit in die Berichterstattung einfließen. So erwähnten mehrere Publikationen in Zusammenhang Netanjahus Korruptionsvorwürfen auch die sexuellen Verfehlungen Katsavs. Im Gegensatz dazu habe ich noch keinerlei Bezüge von Schröders Rentenvergoldung bei Gazprom und Edathys Vorliebe für Kinderpornographie in einem Artikel gefunden.
Wer´s noch nicht glaubt, kann nachzählen wie oft bei SPON oder SZ in den letzten zwei Wochen im Zusammenhang mit Israel oder israelischen Politikern das Wort "Erzfeind" gefallen ist.
Dazu gehören auch historische Verfälschungen, wie sie inzwischen Gang und Gäbe sind, Ursache und Wirkungsumkehr, wie bei den Elchen, der Gebrauch von Begriffen wie "Apartheid" (der dicke Siggi sollte mal nachschauen welches Wahlrecht hier lebende Nichtdeutsche haben), die Relativierung des Holocaust durch jeden Deppen, der damit seine eigene Agenda dramatisieren will, jeden erlogenen Poops eines BDS Klons unhinterfragt medial zu multiplizieren, und deren "kauft nicht bei Juden" Propaganda auch noch mitzutragen. Es wirkt bei den Einzelhändlern, die Produkte aus Regalen nehmen und Unternehmern, die mit dem Iran Geschäfte machen wollen. Und bei den Autofahren die den Juden die Ölkrise nie verziehen haben.
Und es passiert täglich, ach was, minütlich (dank Interweb) im überwigenden Teil der deutsch/europäischen Medienlandschaft. Seit Jahren. Und vom halbverblödeten Kastelguckerhipster bis zum Professor glauben langsam alle, dass ein paar Millionen Juden den Rest der 8 Milliarden Menschen irgendwie kontrollieren, am Sprechen hindern und sowieso hinter allem stecken.
I´m not gonna take it, never did and never will (The Who)
Wenn man lange genug in den Abgrund schaut, schaut der Abgrund irgendwann zurück
Epilog
Natürlich liegt hinter dem ganzen auch etwas persönliches. Möglicherweise sind meine Motive nicht nur lauterer Natur. Möglicherweise projeziere ich mein gelegentlich auftretendes neurotisches Gefühl des Nichtverstandenseins, mein alle sind gemein zu mir und keiner liebt mich manchmal auf Israel.
Möglicherweise hat mein opportunistischer Nazivater (der später gern die FDP wählte) einen ödipalen Reflex in mir ausgelöst, der bis heute wirksam ist.
Auch das analysieren sprachlicher Feinheiten ob ihres antisemitschen Gehalts, obwohl es in eigenen Texten von Fehlern wimmelt, könnte auf eine Neigung zur Rechthaberei hinweisen.
Es ändert aber nichts daran, dass der Pilot den Elch getötet hat und damit den Hubschrauber zerstörte.
0 notes
Text
Biowaffen - Mittel für den Genozid

Wie du mir
Zur Vorgeschichte des russischen Einmarsches in die Ukraine gehört auch eine massive Eskalation des Westens durch die Arbeit an biologischen Waffen. Teil 1/3.
von Flo Osrainik
Mit Russlands direktem Eingriff in den Ukrainekrieg oder dem Angriff auf die Ukraine explodiert das Imperium der Heuchelei jetzt endgültig und setzt ein Virus hemmungsloser Russophobie frei, das im Westblock der doppelten Standards für doppelte Apartheid sorgt. Gebrodelt hat es ja schon lange. Dass die russische Regierung nun doch nach Kiew marschieren lässt, ist dabei so einiges mehr als „nur“ ein Bruderkrieg. Über das, was ist, und wie es dazu kam. Ein Kommentar von Flo Osrainik, dem Autor des Spiegel-Bestsellers „Das Corona-Dossier“.
Vom (Bio-) Kriege
Mit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine wurde eine neue Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg, dem russisch-ukrainischen Konflikt, in einem ohnehin global verrohten Irrenhaus gezündet, um die geopolitischen Verhältnisse zurechtzubiegen. Oder nicht noch weiter zu verschieben. Mindestens in dieser Region. Immerhin kennt die Nato seit rund dreißig Jahren nur eine Richtung, keine Grenzen und mit Russland einen ganz besonderen Lieblingsfeind.
Vom einstürzenden Corona-Narrativ, dem Versagen und den Schäden der Corona-Impfung kann der politisch-mediale Komplex nun aber auch ablenken. Das in die Köpfe und Gesetze gehämmerte und jederzeit abrufbare Pandemie-Regime zur besseren Kontrolle der Weltbürger bleibt ja weiterhin gesetzt. Und ausgerechnet am 24. Februar 2022, dem Beginn des militärischen Ein- und Angriffs Russlands, veröffentlichte die WHO einen ausführlichen Bericht mit dem Titel „COVID-19: Forschung und Innovation. Die weltweite Pandemiebekämpfung vorantreiben — jetzt und in Zukunft“. Auf der sechsten Seite heißt es darin:
„Die Weltgesundheitsversammlung vereinbarte im Dezember 2021 die Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zur Bekämpfung von Pandemien.“
Und wann fand die erste Verhandlung statt (1, 2)?
Auch am 24. Februar. Da traf sich nämlich der „Intergovernmental Negotiating Body“ (INB) der WHO „zur Ausarbeitung eines internationalen Pandemievertrags“. Die von speziellen Stiftungen und Sponsoren oder eben Oligarchen privatfinanzierte WHO — die WHO wird lediglich zu rund einem Viertel von Beiträgen ihrer Mitgliedsländer finanziert — soll in Zukunft noch mehr Macht über genau diese 194 WHO-Mitgliedsstaaten, ihre Menschen und Daten bekommen. Alles unter dem Vorwand oder Konzept: „Eine Gesundheit“, so die offizielle Bezeichnung.
Nur wenige Tage später haben russische Einheiten dann ukrainische Biolabors eingenommen und sind in den Besitz von Dokumenten gelangt, aus denen hervorgehen soll, dass die Ukraine an der Entwicklung von Komponenten für biologische Waffen beteiligt ist. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte einen Teil der Dokumente.
Laut Igor Konaschenkow, dem Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums, wurden „im Zuge der Durchführung der besonderen Militäroperation“ Beweise gefunden, „dass das Kiewer Regime die Spuren“ eines vom ���US-Verteidigungsministerium finanzierten militärisch-biologischen Programms in der Ukraine in überstürzter Weise zu beseitigen versuchte“.
Die Welt sollte nichts von einem Verstoß Washingtons und Kiews gegen das Verbot von bakteriologischen, also biologischen sowie von Toxinwaffen nach Artikel 1 des UN-Übereinkommens erfahren.
„Wir haben von Mitarbeitern der Biolabors auf dem Gebiet der Ukraine Unterlagen über die zur Vertuschung vorgenommene Vernichtung besonders gefährlicher Krankheitserreger — Erreger der Pest, des Milzbrands, der Tularämie, Cholera und anderer tödlicher Krankheiten — erhalten“, so Konaschenkow. Es seien auch Experimente mit dem Fledermaus-Coronavirus durchgeführt worden.
Die USA beabsichtigten, „an Krankheitserregern von Vögeln, Fledermäusen und Reptilien zu arbeiten“ und zu erforschen, ob diese Tiere „das Virus der Afrikanischen Schweinepest und Milzbrand übertragen können“. Dem Pressesprecher zufolge untersuchten die Wissenschaftler auch die Möglichkeit der Übertragung von Krankheitserregern durch Wildvögel, die zwischen der Ukraine, Russland und anderen Nachbarländern umherziehen. An 145 Vogelarten wurde geforscht. Außerdem sei es „sehr wahrscheinlich“, dass ein Ziel der USA und ihrer Verbündeten die Entwicklung von Bioagenten ist (3, 4, 5, 6).
Auch die WHO riet der Ukraine, gefährliche Krankheitserreger zu zerstören, „die in öffentlichen Gesundheitslaboren des Landes untergebracht sind“, um zu verhindern, dass sich die Krankheiten wegen der russischen Angriffe unter der Bevölkerung ausbreiten.
„Wie viele andere Länder verfügt die Ukraine über öffentliche Gesundheitslabors, die untersuchen, wie die Bedrohung durch gefährliche Krankheiten, die sowohl Tiere als auch Menschen betreffen, einschließlich COVID-19 gemindert werden kann. Die Labors wurden von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und der WHO unterstützt.“
Das teilte nun nicht Russland, sondern die britische Nachrichtenagentur Reuters der Öffentlichkeit mit. Und zwar am 10. März, also erst ein paar Tage, nachdem Russland die Dokumente aus der Ukraine präsentierte. Laut Reuters bestätigte „die WHO in einer Mail, dass sie seit mehreren Jahren mit ukrainischen Gesundheitslaboren zusammenarbeitet, um Sicherheitspraktiken zu fördern, die dazu beitragen, eine ‚versehentlich oder absichtliche Freisetzung von Krankheitserregern‘ zu verhindern“. Und im Rahmen dessen hätte die WHO dem ukrainischen Gesundheitsministerium nun dringend empfohlen, „stark gefährdete Krankheitserreger zu zerstören“.
Allerdings wollte die WHO nicht bekannt geben, wann sie diese „Empfehlung abgegeben hatte“, um welche „Arten von Krankheitserregern oder Toxinen, die in den ukrainischen Laboren untergebracht sind“, es sich handelt oder ob die WHO-Empfehlung auch befolgt wurde. Und, so Reuters, ukrainische Beamte in Kiew und der Botschaft in Washington „reagierten nicht auf Anfragen“ dazu (7).
Igor Kirillow, der Leiter der ABC-Schutztruppen der russischen Streitkräfte, gab dann ebenfalls am 10. März Details zu den einzelnen Projekten bekannt, bei denen unter anderem der Einsatz von Zugvögeln und Fledermäusen als Träger potenzieller Biowaffenagenten untersucht wird. Bemerkenswert wäre die Tatsache, dass die Forschung in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen — entlang der Schwarzmeerküste und im Kaukasus — stattfindet. Auch Biolabore in Georgien wären beteiligt, die dem Pentagon unterstellt sind.
Darüber hinaus würden die vorliegenden Dokumente die Weitergabe biologischer Proben ukrainischer Bürger ins Ausland bezeugen, etwa nach Australien oder Deutschland. Mit hoher Wahrscheinlichkeit könne man sagen, „dass eines der Ziele der USA und ihrer Verbündeten darin besteht, biologische Kampfstoffe zu entwickeln, die selektiv verschiedene ethnische Bevölkerungsgruppen angreifen können“.
Mit der Einführung des Kriegsrechts in der Ukraine am 24. Februar wurde dann ein Präsidialerlass verabschiedet, aufgrund dessen das ukrainische Gesundheitsministerium zu der von der WHO empfohlenen „Notvernichtung von biologischen Krankheitserregern, die zur Sicherstellung des Qualitätsmanagementsystems der Laborforschung verwendet werden“, auffordert. Doch nicht nur Russland, auch die Regierung in China verlangt mehr Transparenz über die Bioforschung in der Ukraine — die US-Regierung finanziert seit den 2010-er Jahren übrigens auch Forschungsprojekte in der größten (Corona-)Virusbank Asiens, dem Institut für Virologie in Wuhan zur Übertragung des Coronavirus.
Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhào Lìjian, forderte die USA dazu auf, „ihre Aktivitäten zur biologischen Militarisierung im In- und Ausland vollständig aufzuklären“. Und „so bald wie möglich“ offenzulegen. Er betonte, auch Peking verfüge über Informationen, die belegen, dass die militärisch-biologischen US-Aktivitäten in der Ukraine bloß „die Spitze des Eisbergs“ wären.
Zhào behauptete, dass das Pentagon „336 biologische Labors in 30 Ländern auf der ganzen Welt“ kontrolliere. Das geheime US-Programm liefe allerdings unter dem Deckmantel der Bemühung um die „Verringerung von Biosicherheitsrisiken“ und zur Stärkung der „globalen öffentlichen Gesundheit“ (8).
Victoria „The Honorable“ Nuland, stellvertretende US-Außenministerin, gestand am 8. März bereits ein, dass die USA diverse Biolabors in der Ukraine betreiben. Nuland sagte vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats:
„Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, bei denen wir in der Tat besorgt sind, dass russische Truppen oder russische Streitkräfte versuchen könnten, die Kontrolle darüber zu erlangen.“
Und: „Wir arbeiten mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen, sollten diese sich nähern.“ Präventiv gab Nuland dann Russland die Schuld für eine mögliche Freisetzung gefährlicher Stoffe in der Ukraine. Es sei „eine klassische russische Technik, dem anderen die Schuld für das zu geben, was man selbst vorhat“.
Kiew und Washington bestritten stattdessen, Biowaffen entwickelt zu haben. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj würden sich die Labors nur „mit normaler Wissenschaft“ und nicht mit Militärtechnologie befassen. Und was, wenn angeblich „normale Wissenschaft“ missbraucht wird, etwa zu (geo-)politischen Zwecken und ganz in zivil? Womöglich im Auftrag von Diensten?
Das Pentagon bestritt immerhin auch, dass es diese Programme in den ehemaligen Sowjetstaaten überhaupt gibt. Das sei bloß „russische Desinformation“. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, beschuldigte Russland etwa „absichtlich glatte Lügen“ zu verbreiten, man hätte die russischen Behauptungen „über viele Jahre hinweg schlüssig und wiederholt entlarvt.“ Auch das US-Außenministerium drehte den Spieß um oder versucht es. Stattdessen würde Moskau, „aktive chemische und biologische Waffenprogramme“ betreiben. Vielleicht ist es, aber auch nur eine klassische US-Technik, zu verwirren (9, 10).
Jedenfalls warnte in Reaktion auf die veröffentlichten Labor-Dokumente Russlands in der Ukraine und der Reaktion Chinas dazu dann auch noch Großbritannien, das sich auch im 21. Jahrhundert minderdemokratisch noch immer ein Königreich nennt, zusammen mit den USA und anderen NATO-Staaten vor einem angeblich kurz bevorstehenden Angriff Russlands in der Ukraine mit chemischen oder biologischen Waffen. Und zwar unter falscher Flagge.
Das britische Verteidigungsministerium hatte auf Twitter außerdem behauptet, Russland habe Raketenwerfen mit thermobaren Sprengköpfen, die auch als Aerosol- oder Vakuumbomben bezeichnet werden, in der Ukraine eingesetzt. Und einem BBC-Bericht zufolge befürchten voreingenommene westliche Beamte eine biochemische Attacke Moskaus. Davor müsse man auf der Hut sein (11).
Der Einsatz von Biowaffen ist alt. Und mit Biowaffenlaboren kennen sich die USA aus. Das US-Biowaffenlabor in Fort Detrick wurde in der Vergangenheit zur Entwicklung von Biowaffen genutzt. Auch gegen US-Bürger. In der „Operation Sea-Spray“ wurden nach dem Zweiten Weltkrieg über mehrere Jahre bei Experimenten Keime ohne Wissen der Bevölkerung in der Luft versprüht.
Einer der ersten dokumentierten Einsätze biologischer Waffen geschah übrigens schon vor rund 250 Jahren, als die Briten beim Pontiac-Aufstand, auch bekannt als Pontiac-Verschwörung, einem Krieg sogenannter Indianerstämme gegen die britische Vorherrschaft in Nordamerika, mit Pockenerregern verseuchte Decken benutzten, um die Ureinwohner Nordamerikas, die mit Guerillataktik kämpften, zu dezimieren (12).
Hat Moskau am 24. Februar in der Ukraine also womöglich auch ein- oder angegriffen, weil Geheimlabors dort mit der Herstellung chemischer und biologischer Waffen beschäftigt waren?
Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnete die US-amerikanischen Biolabore auf dem Territorium der Ukraine ja als „Instrument einer direkten Bedrohung Russlands“. Russland forderte zu den militärischen und biologischen Aktivitäten der USA in der Ukraine übrigens auch eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Oder dient die Forschung des US-Imperiums in den ukrainischen Laboren tatsächlich nur der selbstlosen WHO-Gesundheit zum Wohle aller Menschen, auch der Russen?
Das russische Verteidigungsministerium geht zumindest davon aus, dass die USA mehr als 200 Millionen US-Dollar für ukrainische Labore ausgegeben haben, die an militärisch-biologischen Programmen der USA beteiligt waren.
Die US-Botschaft in Kiew bestätige übrigens, dass das US-Verteidigungsministerium „mit Partnerländern zusammenarbeitet“. Allerdings nur, so die offizielle Version, um „der Gefahr von Ausbrüchen zu begegnen“. Die US-Botschaft informiert dazu auf ihrer Internetseite auch über ein seit dem Jahr 2016 vom US-Verteidigungsministerium betriebenes Forschungsprogramm zur Reduzierung sogenannter biologischer Bedrohungen (Biological Threat Reduction Program, kurz BTRP) in der Ukraine.
Die US-Botschaft schreibt, dass „die sanitär-epidemiologische Abteilung (SED) des Medizinischen Kommandos des ukrainischen Verteidigungsministeriums“ vier mobile Labore mit dem Ziel erhielt, „das System der epidemiologischen Überwachung in den Streitkräften der Ukraine zu stärken. Das ukrainische Verteidigungsministerium erhielt vom Ministerkabinett der Ukraine eine offizielle Anordnung über die Entsendung der mobilen Labore in die Regionen Kiew, Lemberg und Ostukraine, um bei der Reaktion auf COVID-19 zu helfen. Am 11. April 2020 besuchte Präsident Selenskyj die SED-Einheit in der Stadt Pokrowskoje, Oblast Donezk, und machte sich mit den Fähigkeiten der mobilen Labore vertraut, um Militär- und Zivilpersonen während der COVID-19-Epidemie zu helfen. BTRP hat viele Labore für das Gesundheitsministerium und den Staatlichen Dienst für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz der Ukraine modernisiert und die Biosicherheitsstufe 2 erreicht. Im Jahr 2019 errichtete BTRP zwei Labore für Letztere, eines in Kiew und eines in Odessa“.
Weiter schreibt die US-Botschaft auf ihrer Seite, dass mit dem 2016 gestarteten „Science Writing Mentorship Program (SWMP)“ der Fokus auf der Förderung von „Eine-Gesundheit-Initiativen“ („One Health initiatives“) sowie „der Minderung von Krankheitsrisiken in der Ukraine durch eine effektive Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse in BTRP-unterstützten Labors liegt. Das Programm zielt darauf ab, die wissenschaftlichen Schreibfähigkeiten der Teilnehmer zu verbessern, um ihnen die Möglichkeit zu geben, zu veröffentlichen und Stipendien für Projekte zu erhalten. Darüber hinaus gibt es ein jährliches Ukraine Regional One Health Research Symposium“.
Weiter heißt es, dass das BTRP viele gemeinsame Forschungsprojekte unterstützt, in denen ukrainische und US-amerikanische Wissenschaftler zusammenarbeiten. Bei diesen Forschungsprojekten ginge es um die Risikobewertung, Prävalenz oder Verbreitung und Übertragung verschiedener Viren, Virusisolation durch Genomsequenzierung oder Bioüberwachung sowie den Aufbau von Kapazitäten.
Das Gesundheitsministerium der Ukraine und der Staatliche Dienst der Ukraine für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz hätte im Jahr 2016 auch „ein Memorandum über den Beitritt zu einer multinationalen Arbeitsgruppe mit dem Ziel, die globale Gesundheitssicherheit zu stärken und gut funktionierende Krankheitsüberwachungsnetzwerke in der osteuropäischen Region zu schaffen, zu der Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan und die Ukraine gehören“, unterzeichnet (13).
Nun konnte man auf der Internetseite der US-Botschaft Informationen über das US-Bioforschungsprogramm und Dokumente zu den ukrainischen Laboren des gemeinsam betriebenen Forschungsprojekts herunterladen. Seit dem Abend des 26. Februars, zwei Tage nach dem begonnenen Einmarsch russischer Kräfte, ist das nicht mehr möglich. Der Zugriff wurde ohne Angabe von Gründen gesperrt.
Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, meinte gegenüber der russischen Zeitung Kommersant im Jahr 2021 über Spekulationen zur Herstellung biologischer und chemischer US-Waffen in unmittelbarer Nähe zu Russlands Grenzen:
„Ich schlage vor, dass Sie sich ansehen, wie immer mehr biologische Labore unter US-Kontrolle in der Welt entstehen, und zwar zufälligerweise vor allem an den Grenzen Russlands und Chinas“ (14).
Übrigens unterhält das Pentagon nicht nur in Osteuropa, sondern auch in Asien oder Afrika Biolabore und erteilt etwa der US-Organisation EcoHealth Alliance zivile und militärische Aufträge, um (auch) neue Coronaviren auf der ganzen Welt zu suchen. In „Das Corona-Dossier“ schreibe ich unter Verweis auf die investigative Journalistin Dilyana Gaytandzhieva:
„Im Jahr 2016 startete diese Allianz, US-Wissenschaftler und die United States Agency for International Development (USAID) das ‚Global Virome Project‘ zur ‚Vorbereitung auf die nächste Pandemie‘, ein Milliarden-US-Dollar-Projekt, um neue, in freier Wildbahn auftretende Krankheiten zu identifizieren, die sich auf Menschen ausbreiten und zu einer Pandemie werden können. ‚Die Rockefeller Foundation unterstützt solche Projekte schon länger.‘“
Und mögliche Verstrickungen des US-Chef-Virologen Anthony Fauci, dem Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), mit dem Institut für Virologie in Wuhan, der US-Verteidigungsbehörde Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), der EcoHealth Alliance in Zusammenhang mit der Gain-of-function-Forschung, um Viren und Bakterien schneller mutieren zu lassen, lasse ich hier mal beiseite (15, 16, 17).
Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch noch ein Zitat von Robert Kadlec, Ex-Programmdirektor für Biodefense des Homeland Security Department, ehemaliger US-Biowaffeninspektor im Irak und unter US-Präsident Donald Trump stellvertretender Sekretär des US-Gesundheitsministeriums, in einem internen Strategiepapier des Pentagons aus dem Jahr 1998. Kadlec damals:
„Werden biologische Waffen unter der Tarnung einer räumlich begrenzten oder natürlich auftretenden Seuche benutzt, lässt sich ihr Einsatz glaubwürdig abstreiten. (…) Das Potenzial, schwere wirtschaftliche Verluste und in der Folge politische Instabilität auszulösen, verbunden mit der Möglichkeit, den Einsatz glaubwürdig abstreiten zu können, übertrifft die Möglichkeiten jeder anderen bekannten Waffe.“
Dass die USA beziehungsweise die Nato, nachdem es unter dem russischen Präsidenten Boris Jelzin von 1991 bis 1999 mit der Übernahme Russlands nicht so recht klappte, einen Regime-Change im Kreml anstreben, ist ja auch kein großes Geheimnis mehr (18).
Das Völkerrecht des Stärkeren
Bei Russlands sogenannter „Militäroperation“, der Westblock stapelt für gewöhnlich nicht so tief und spricht bei seinen Kriegen gerne mal von Freiheits- oder Schutzmissionen — „Operation Iraqi Freedom“ für den Irakkrieg, „Unified Protector“ im Libyenkrieg, Russlands Angriff gilt dagegen als offener „Überfall“ und „Angriffskrieg“ —, handelt es sich auch oder trotz der US-Biowaffenlabore nahe der russischen Grenze um einen Völkerrechtsbruch.
Allerdings nur einen von vielen. Und den begehen dieses Mal eben nicht die Nato-Staaten. Russland hat sich das Recht des Stärkeren genommen. Deswegen sind die Russen jetzt die Bösen mit niedersten Motiven. Na ja, entweder es gilt ein Maß für alle oder keines für keinen. Das ist dann meinetwegen auch die Erklärung, warum sämtliche Nato-Völkerrechtsbrüche unter US-Führerschaft auch in hundert Jahren zu keinerlei Sanktionen und Boykotten, zu keiner Zensur, Empörung, Solidaritätsbekundung, Beflaggung, Sippenhaft, Verbannung, Enteignung, Missachtung des hippokratischen Eids, Diskriminierung und blankem Hass gegenüber den Angriffskriegern führten. Und schon gar nicht gegenüber Kindern, Gästen, Künstlern oder Sportlern, sogar körperlich behinderten.
Immerhin
Lesen Sie den ganzen Artikel
0 notes
Text
Menschenwürdiges Hartz IV! | Rubikon
Neuer Beitrag veröffentlicht bei https://melby.de/menschenwuerdiges-hartz-iv-rubikon/
Menschenwürdiges Hartz IV! | Rubikon
Es könne nicht sein, dass man als unter 50-Jähriger dem Staat jahrelang auf der Tasche liege, aber am Ende keine Gegenleistung bringe, so Christian Gräff weiter. Gräff betreibt seit vielen Jahren mit seinem Bruder Andreas den erfolgreichen Online-Organhandel Amazorgan, die einzige Organplattform weltweit mit 30 Tagen Rückgabegarantie.
Der neue Perso-rganspendeausweis sei wie eine Zehnerkarte im Freibad so konstruiert, dass man ihn mit einer kleinen Metallzange abknipsen könne. Für ein Jahr Hartz-IV-Bezug müsse sich der „Arbeitsverweigerer“ (CDU-Sprache) zukünftig wahlweise von seinen Haaren, einer Niere, einem Teil der Lunge, einem Stückchen Bauchspeicheldrüse oder von etwas anderem trennen.
Um ganze zehn Jahre Hartz-IV zu beziehen, müssten die Schmarotzer (ebenfalls CDU Sprache) sich mit dem zehnten und letzten Stempel schließlich bereit erklären, den eigenen Körper freiwillig der Wissenschaft oder, wovon man im Regelfall ausgehen dürfe, der Futtermittelindustrie – Pedigree Pal – zur Verfügung zu stellen. „Keine Leistung mehr ohne Gegenleistung“, das sei das christliche Grundprinzip demokratischer Unions-Politik, so Gräff mit einem Lächeln im Gesicht. Das gebe dann endlich auch all den Armen und Bedürftigen im Land ihre Würde zurück. Denn alles sei freiwillig. Wer essen wolle, spende eben seine Organe – aber niemand werde dazu gezwungen!
Doch das ist lange noch nicht alles: Um den Haushalt weiter zu entlasten, hat die CDU noch weitere Konzepte in der Schublade. So sollen ab 2020 Rentner, die es nicht geschafft haben, bis zu ihrem 70. Lebensjahr zu sterben, keine Rente mehr bekommen. Sie müssten begreifen, dass es irgendwann auch mal gut sei, so ein Sprecher der Christlichen Union, der sogar fordert, das alte Lied von Udo Jürgens umzutexten auf: „Mit 66 Jahren da hört das Leben auf.“
Einwände gegen diese drastischen Eingriffe kamen allerdings umgehend vom ZDF, das nun um seine Kernzielgruppe fürchtet. Auch der Verband deutscher Pharmaunternehmen protestierte in einer eilig verfassten Stellungnahme. Gerade die 70- bis 90-Jährigen seien meist chronisch krank und damit eine hervorragende Einnahmequelle, auf die man in Zukunft unter keinen Umständen verzichten könne.
Und da sage nochmal einer, die Pharmaindustrie würde keine Menschenleben retten.
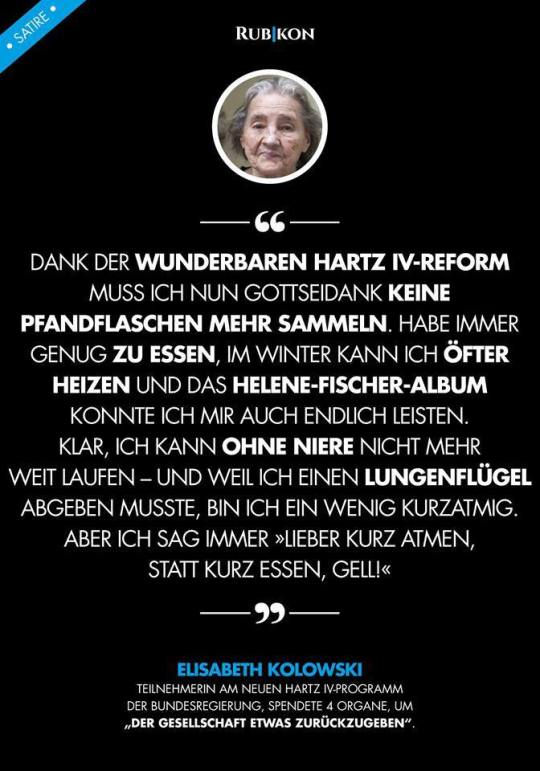
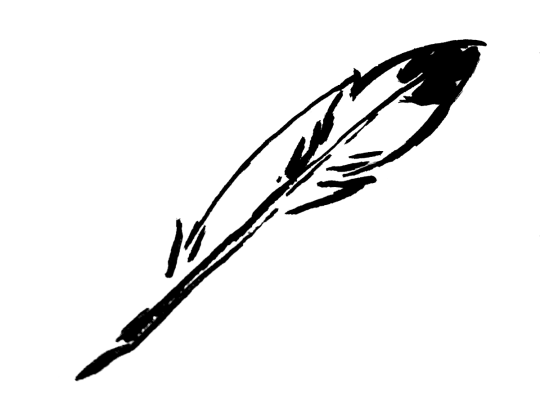
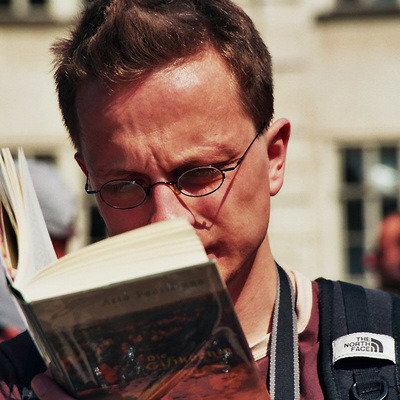
Jens Wernicke, Jahrgang 1977, Diplom-Kulturwissenschaftler (Medien), arbeitete lange als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Politik und als Gewerkschaftssekretär. Er verantwortete mehrere Jahre das Interviewformat der NachDenkSeiten, Deutschlands meistgelesenem politischen Blog. Heute ist er Autor, freier Journalist und Herausgeber von „Rubikon – Magazin für die kritische Masse“. Zuletzt erschienen von ihm als Mitherausgeber „Netzwerk der Macht – Bertelsmann. Der medial-politische Komplex aus Gütersloh“ und „Fassadendemokratie und Tiefer Staat: Auf dem Weg in ein autoritäres Zeitalter“. Sowie von ihm als Autor „Lügen die Medien? Propaganda, Rudeljournalismus und der Kampf um die öffentliche Meinung“.

Jens Lehrich, Jahrgang 1970, ist gelernter Hörfunk-Journalist und freier Autor aus Hamburg. Seit über 25 Jahren produziert, spricht und textet er Comedyserien für den privaten Hörfunk. Als sein Sohn im Jahr 2010 an Typ 1-Diabetes erkrankte, begann für den dreifachen Familienvater der Blick hinter die Kulissen der Pharmaindustrie. Lehrich gründete den Blog ahundredmonkeys.de, auf dem er Menschen präsentiert, die abseits vom Mainstream für eine bessere, gerechtere und gesündere Gesellschaft eintreten. Darüber hinaus gehören das Klavierspielen und Schreiben von Satire zu seinen Leidenschaften.
Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International) lizenziert. Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen dürfen Sie es verbreiten und vervielfältigen.

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, können Sie hier eine Spende abgeben. Da wir gemeinnützig sind, erhalten Sie auch eine Spendenquittung.
Rubikon Magazin
Jens Wernicke
Quelle
قالب وردپرس
0 notes
Text
Festival: Berlinale 2017
Knapp vorab: Eine Woche lang habe ich mich mit teils lebensgefährlichen Koffeindosierungen durch verschiedenste Kinosäle geschleppt, um möglichst viel von der 67. Berlinale mitnehmen zu können. Ziemlich genau sieben weitere Tage später habe ich meine Gedanken bezüglich gesichtetem Material, Presseecho und dem Festival als solchem so weit sortiert, dass ich dem Internet eine subjektive Einschätzung zumuten möchte. Ausführliche Rezensionen entfallen im folgenden Text zugunsten eines bunten Panoramas; fleißig besprochen haben aber etwa die Kollegen bei critic.de, falls euch sowas interessieren sollte.
Natürlich, ganz kalt lässt einen das nicht, wenn man kurz vor Ende der Berlinale von einer internationalen Jury erfährt, wirklich nahezu alles falsch gemacht zu haben. Na gut, den Film des mit dem silbernen Bären ausgezeichneten Regisseurs Aki Kaurismäki hatte ich mitgenommen, aber der stellte auch vor irgendwelchen Prämierungen eher Festival-Pflicht denn Kür dar. Auf der Haben-Seite lässt sich also maximal "Bamui haebyun-eoseo honja" verbuchen, für den Kim Minhee als beste Hauptdarstellerin prämiert wurde, ansonsten schlängelte sich meine persönliche Programmgestaltung gekonnt an den Gewinnern vorbei. Relativiert wird dieses Versäumnis von den nachgereichten Pressestimmen: Die Berlinale, wieder mal Debakel, die falschen Filme im Wettbewerb, insgesamt viel zu bieder und daher absolut folgerichtig, dass sich bei der Preisverleihung niemand so recht freuen mochte, Kaurismäki seinen Preis etwa gleich gar nicht haben wollte und irgendwo zwischen Betrunkenheit und blanker Ablehnung auf seinem Sitz verharrte. Das Beklatschen dieser Geste erinnert unangenehm an die medialen Reaktionen auf die Verleihung des Literaturnobelpreises an Bob Dylan: Irgendwie hat sich in der Presse ein tiefes Misstrauen gegenüber derartigen Auszeichnungen eingeschlichen, und die Ignoranz der Prämierten ihrer Prämie gegenüber wird in der Folge als diffuses Zeichen von Dissidenz gelesen. Es ist nicht so, als hätte ich kein Verständnis für dieses Misstrauen oder würde es nicht teilen, schleierhaft bleibt jedoch der Ansatz, der Verleihung weiterhin Bedeutung beizumessen und ihr Scheitern dann selbstgerecht nachträglich in den eigenen vier Wänden als logische Konsequenz abzufeiern.
Eine Alternative könnte hingegen ja auch die Einsicht sein, dass derartige Preise immer irgendwie suspekt sind und die Berlinale stattdessen als Forum zu begreifen, auf dem sich gewisse Filme präsentieren (ein Faktor, der bei der Dissidenten-Lesart gerne unterschlagen wird) und der Besucher letzten Endes selbst entscheidet, welches Angebot er wahrnehmen und im Anschluss als miss- oder gelungen klassifizieren möchte. Vor diesem Hintergrund, der weniger die kuratorischen Entscheidungen des Festivals denn die Filme an sich bzw. die sich aus der individuellen Sichtung ergebenden Zusammenhänge fokussiert, erscheint die Berlinale gleich in ganz anderem Licht, etwa was den Blick auf zeitgenössische, gesellschaftliche Probleme angeht. Selten standen sie so deutlich im Vordergrund wie in Kaurismäkis nüchtern-humanistischem "Toivon tuolla puolen", häufig waren sie eher als Fetzen präsent, die durch mediale Vermittlung in den Alltag der Figuren eindrangen und dabei die eigentlich behandelten Probleme gewaltig relativierten, selbst wenn es dabei wie im Falle des bedächtigen chinesischen Animationsfilms "Hao Ji Le" um Leben und Tod ging. Weniger dramatisch gestaltete sich etwa Josef Haders Regiedebüt "Wilde Maus", das mit lakonischem Humor das Thema Midlife Crisis verhandelte und das komplexe Innenleben mittelständlerischer Westeuropäer durch permanente Präsentation von Nachrichtenbeiträgen aus den Krisenherden der Welt mal mehr, mal weniger subtil karikierte. In jedem Fall gelang es Hader mit dieser Entscheidung, der aktuellen Lage spielerischer und damit effektiver beizukommen, als es das klassische Sozialdrama zu leisten im Stande ist.
Raum gab es für menschliches Elend dennoch zu Genüge, etwa in der streng durchgetakteten Suizid-Groteske "Rekvijem za gospodju J.", durch die der noch immer anhaltende, postsowjetische Schockzustand ebenso hallt wie der private, lähmende Schmerz, den der Tod eines geliebten Menschen mit sich bringt. Ähnlich gelähmt präsentiert sich das ruinöse Mazedonien in "When The Day Had No Name", selbst wenn eine Gruppe junger Menschen versucht, mit unterschiedlichen Mitteln der allgegenwärtigen Trostlosigkeit zu entkommen. Der Stillstand, ebenso wie der kontrastierende Gewaltexzess, geisterte durch etliche weitere Berlinale-Filme wie den ereignisarmen "Bamui haebyun-eoseo honja", das (wortwörtlich) zerfetzte Biopic "Joaquim" und vor allem den meditativen Programmhöhepunkt "Ghosts In The Mountains", der in sehr langen Einstellungen durch das chinesische Hinterland kriecht und dabei neben all der perfekt eingefangenen Schönheit vor allem den Blick auf eine Leere richtet, die auch Alkohol, Geld und Zigaretten nicht füllen können. Am Ende sind es, ähnlich wie in "When The Day Had No Name", auch hier Jugendliche, die vergebens versuchen, die starren Muster der Gesellschaft aufzubrechen und dabei vor allem Unheil heraufbeschwören.
Um den Konflikt von Alter und Jungend in Personalunion geht es auch in "Fünf Sterne", einer minimalistischen Bestandsaufnahme von Annekatrin Hendel, die hier einige Wochen lang ihre Freundin Ines in einem klaustrophobischen Hotelzimmer an der Ostsee begleitet und mit der Kamera aus dem Off Schicht für Schicht das Dilemma einer Frau freilegt, die an den eigenen, kühn formulierten Ansprüchen ihres - zu Beginn des Films gekonnt eingefangenen - jüngeren Ichs scheitert. Umgesetzt ist das enorm reduziert, die Form stützt dabei jedoch den intimen, desolaten Inhalt ungemein. Unverständlich bleibt hingegen, wieso die Künstlerdoku "Tania Libre" gerade in den ersten Minuten beinahe stümperhaft montiert wirkt - zusätzliche Interviews sind ungünstig formatiert, der Schnitt wirkt teils beliebig, ganz so, als hätten in der Postproduktion irgendwann Zeit und Geld gefehlt. Ärgerlich, denn inhaltlich fasziniert das Zwiegespräch zwischen der angenehm wenig traumatisierten Tania Bruguera und ihrem Therapeuten Frank Ochberg als spannende Reflektion über politische Kunst und ihre realen Konsequenzen in einem wenig freien Land wie Kuba, ohne dass der Film oder seine Protagonisten dabei die eigenen politischen Absichten verschleiern. Deutlich distanzierter fällt die im Wettbewerb laufende Dokumentation über Joseph Beuys aus, der selbst natürlich ein hochpolitischer Künstler war und als solcher auch gezeichnet wird. Mit Archivaufnahmen und einigen gezielt ausgesuchten Interview-Schnipseln montiert Andres Veiel das differenzierte Bild eines häufig ausgestellten, aber vermutlich deutlich seltener verstandenen Künstlers, ohne dabei selbst Partei ergreifen zu wollen. Dem Menschen Beuys kommt der Zuschauer nur bedingt näher, doch gerade dadurch weiß "Beuys" zu überzeugen.
Wem dieser Ansatz zu brav ist, für den bietet der explizit queere Film explizit agitatorische und generell explizite Auswege; "The Misandrists" etwa, ein von Bruce LaBruce erdachtes Revoluzzer-Märchen, in dem ein Haufen radikalisierter Frauen langsam die Beseitigung des Mannes aus dem Weltgeschehen plant und dabei auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurückschreckt. Irgendwo zwischen Trash, Camp und Plädoyer für mehr oder eben weniger Toleranz gelang LaBruce jenes Spiel mit Provokation und Message, dass die Berliner Künstlerin Shu Lea Cheang mit ihrem Beitrag "Fluidø" verfehlte. Das Setting - im Jahr 2060 ist die Welt von Aids geheilt, eine Mutation des HI-Virus dient jedoch mittlerweile als Droge - lässt sich hauptsächlich über die Angaben im Programmheft nachvollziehen, der Film selbst begnügt sich mit obskuren 3-D-Animationen, sehr, sehr vagen Sci-Fi-Anleihen und jeder Menge Ejakulat. Einige Besucher fühlen sich davon angenehm schockiert, leider gerät das Ergebnis allzu redundant und in das eigene Potential verliebt, um es voll entfalten zu können. Nichts gegen den guten, alten Experimentalfilm, doch "Fluidø" erschien dann mit Blick auf zeitgenössische Sehgewohnheiten doch eher faul als gewagt.
Zumal eine ordentliche Bearbeitung des Science-Fiction-Themas wunderbar zur Retrospektive der diesjährigen Berlinale gepasst hätte. Zwischen Anime, sowjetischer Dystopie, amerikanischem Mainstreamkino und europäischer Avantgarde gab es reichlich zu entdecken oder eben noch mal neu abzufeiern, wie etwa "Alien" oder den in diesem Jahr vermutlich von Hollywood verschrotteten "Ghost In The Shell". Inwiefern auch der Marvel-Abgesang "Logan" in diese Reihe passt, sei dahingestellt - obschon angesiedelt im Jahr 2029 macht der letzte aller Wolverine Filme erstaunlich wenig aus seiner Prämisse und einem starken Start. Die Muster, die im Comicbereich vor allem "The Dark Knight Returns" etablierte und die Zack Snyder jüngst vergeblich für das kränkliche Warner-DC-Universum zu adaptieren versuchte, münden bei "Logan" in einem halbherzigen Versuch, die titelgebende Figur endlich mal so zu erzählen, wie sie schon seit dem ersten X-Men-Film angelegt ist. Leider verlässt Regisseur James Mangold irgendwann die eigene Courage und er lässt die ganze, eigentlich so gekonnt mit unterschiedlichen Genres liebäugelnde Story doch wieder konventionell auf einen kitschigen Showdown zusteuern. So bleibt der beste Wolverine-Solo-Ausflug leider immer noch ein ganz schön mittelmäßiger Superheldenfilm.
Wie die Paarung zwischen eiskaltem Killer und geschädigtem Kind unter Beibehaltung von tendenziell kitschigen und explizit blutigen Momenten deutlich besser funktioniert, zeigt der Wettbewerbsbeitrag "Mr. Long". Der Spagat zwischen realistischem Anspruch und der Suche nach irgendeiner Form von Happy End gerät unterwegs zwar auch ins Schlingern, überzeugte letzten Endes jedoch Publikum und Industrie gleichermaßen. Durchwachsener fiel die Reaktion auf "Berlin Syndrome" aus, eine vorsichtige Kombination aus Psychogramm und Thriller, die ein paar Mal in gewohnte Genre-Fallen tappt, insgesamt jedoch mit einem beengenden Setting und stabiler, weil angenehm flexibler Charakterzeichnung auftrumpft; zumal auch hier im Subtext sehr feine politische Bezüge die ehemalige DDR betreffend mitschwingen. Eher nischig mutet auch der außer Konkurrenz im Wettbewerb gezeigte "El Bar" an, der zu Beginn vielleicht etwa zu konstruiert ausfällt und gegen Ende ein, zwei Wendungen zu wenig einbaut, insgesamt aber erfreulich pointiert mit Angst, ihrer medialen Vermittlung und den Erwartungshaltungen des Zuschauers jongliert.
Aus all dem die Tonlage der diesjährigen Berlinale herauszulesen fällt nicht nur schwer, da in diesem Streifzug Sichtungen wie die des ambitioniert in der Vergangenheit wühlenden türkischen Presse-Films "Kaygi", der tristen Geiselnehmer-Ballade "Hostages", der etwas zu behäbigen bhutanischen Film-Noir-Variante "Honeygiver Among The Dogs", des surrealen Lynch-Heimatfilm-Crossovers "Tiere" oder des gekonnt in die Leere laufenden New Yorker Beziehungsfilms "Golden Exits" unter den Tisch fallen, sondern weil selbst die Summe aus 31 gesehenen Filmen die Vielfalt der ausgestellten Positionen kaum repräsentativ abdecken kann. Dennoch ergeben sich bei erneuter Reflektion des Materials Allianzen, etwa über eine gewisse Hoffnungslosigkeit, den Willen, mit Bildern zu schockieren oder die Bedeutung der Natur im Gegensatz zur (gescheiterten) Zivilisation, ebenso wie die Erkenntnis, das die spannenderen Beiträge oft tatsächlich abseits des Wettbewerbs zu finden waren. Doch sollte sich der mündige Kinobesucher nicht gerade das trauen: Kuratorische Entscheidungen aktiv hinterfragen und aus dem - teils natürlich in der Masse fast schon beliebig wirkenden - Festival-Programm ein eigenes bauen?
#berlinale#2017#aki kaurismäki#toivon tuolla puolen#logan#ghost in the shell#sonstiges#festival#berlin#kino#film#berlin syndrome#hugh jackman#max riemelt#the misandrists#bruce labruce#tania bruguera#josef hader
0 notes
Text
Von langer Hand: Was plant der politisch-mediale Komplex?
Ansage: »Sowas kommt von sowas. Und von Nichts kommt Nichts. Totalitäre Bewegungen und Gruppen ticken gänzlich anders als unabhängige Parteien in Demokratien oder gar Freigeister. Ihnen allen gemeinsam ist das Planen von langer Hand, eine radikale Zielstrebigkeit, ein Streben nach maximaler Macht und der Beseitigung oder Einhegung aller nicht dazugehörigen Anderen. Bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung […]
The post Von langer Hand: Was plant der politisch-mediale Komplex? first appeared on Ansage. http://dlvr.it/T4pZnD «
0 notes