Text
Die verliebte Person
Auf der Leinwand des kleinen Kinosaals lief ein alter Film noir, den die Person, von der die verliebte Person etwas wollte, ausgesucht hatte. Der verliebten Person kam diese Filmauswahl recht, da sie ebenjenen Film noir bereits kannte, sogar mehrfach schon gesehen hatte, und wusste, dass die Person, in die die verliebte Person verliebt war, den Film noir ebenfalls kannte und ebenfalls mochte. Die verliebte Person dachte sich, dass diese Filmauswahl daher perfekt sei – ein Film, den beide Parteien kannten und mochten und über dem somit nicht der Tantalosfluch hänge, 90 Minuten lang angespannt beim Betrachten eines unbekannten Films beieinander zu sitzen und verzweifelt auf lustige und spannende Szenen zu hoffen, den unbekannten Film am Ende aber gar dumm, nervig, langweilig oder hanebüchen zu finden, oder noch schlimmer: den unbekannten Film am Ende gar missraten zu finden, während die Person, von der die verliebte Person etwas will, ihn ganz im Gegenteil sehr interessant, lustig, spannend, glaubwürdig findet, und dass man nach dem Verlassen des Kinos entweder ein sehr unangenehmes, konfrontatives Gespräch über Geschmäcker führen müssen würde, das zwangsläufig mit einem kapitulativen Sinnspruch wie „Agree to Disagree“ oder „Naja, über Geschmack lässt sich nicht streiten, was?“ enden würde und alle, wirklich alle zukünftig folgenden Gespräche und Aktivitäten irreperabel kontaminiert hätte; oder aber man hätte das Thema gar nicht erst aufkommen lassen dürfen, hätte also nach dem Schauen des schlechten Films das Kino-Thema beiseite legen müssen wie einen regennassen Mantel beim Heimkommen in die trockene Wohnung, hätte sich nicht nach der Meinung des Anderen erkundigen dürfen aus Angst, er hätte den schlechten Film für überragend gehalten, hätte stattdessen einen möglichst organisch wirkenden Themenwechsel vorschlagen müssen, als sei es vollkommen normal und erwachsen und empfohlenes Date-Verhalten, nach einem Kinobesuch nicht über den soeben gesehenen Film zu sprechen. Die verliebte Person hätte in ihrem Kopf bereits während des Sehens des schlechten Kinofilms dutzende alternative Gesprächsvorschläge für die Zeit nach dem Filmabspann überlegen und durchspielen müssen wie Schachbrettstellungen, hätte im schlimmsten Fall mit der Scham zurande kommen müssen, dass sie es war, die diesen missratenen Film empfohlen, vorgeschlagen, ausgesucht hatte, hätte entweder in die Defensive („Ich dachte, das sei spannender, ich hatte viel Gutes gehört“) oder in die Offensive gehen müssen und komplett das Thema wechseln müssen. Sie hätte dagesessen wie auf heißen Kohlen, wäre sich dann und wann mal durch die Haare gefahren, hätte angefangen, nervös und von der Person, von der sie etwas wollte, möglichst ungesehen mit den Fingern auf dem Kinosessel zu trommeln. Sie hätte vermutlich auch überdurchschnittlich viel geschwitzt. Sie hätte über sich ergehen lassen müssen, dass die Person, von der die verliebte Person etwas wollte, seinen Filmgeschmack für völlig furchtbar gehalten hätte; je länger der Film andauerte und je schlechter und langweiliger er wurde, desto mehr hätte die Person, von der die verliebte Person etwas wollte, ihn mit anderen Augen gesehen, als eine Person, die einen schlechten Filmgeschmack und somit auch einen schlechten menschlichen Geschmack hätte, denn sowas ist schließlich, machen wir uns doch nichts vor!, intrinisch miteinander verbunden; sie hätte sicherlich realisiert, so die Furcht der verliebten Person, dass eine gemeinsame Zukunft der zwei daraus bestehen müsse, permanent schlechte Filme schauen zu müssen, oder aber ermüdende und zunehmend aggressiver werdende Gespräche über Geschmack führen zu müssen. Im Falle dieses gottseidank ja bloß hypothetischen Szenarios – also, dass die beiden einen schlechten Film im Kino gesehen hätten, den die verliebte Person ausgesucht hätte – wäre er sicherlich nach einer Zeit derart verzweifelt und mit seinem Latein am Ende, nach dutzender im Kopf durchgespielter Gesprächsverläufe nach dem Verlassen des Kinosaals, dass er irgendwann in der Mitte des Films es einfach nicht mehr ertragen hätte, so passiv dazusitzen, während die Person, von der er etwas wollte, immer schlechter über ihn zu denken anfing, und so hätte er sicherlich sich irgendwann zu Zweidrittel des Films zu der Person, von der er etwas wollte, herübergelehnt (einer der wenigen Körperkontakte während des Films, da war er sich sicher!) und hätte vorgeschlagen, da dieser Film „ja doch nichts Nennenswertes“ sei, vorzeitig den Saal zu verlassen und irgendwo etwas trinken zu gehen oder dergleichen. Das allerdings wäre zwar im Kopf sicherlich wie eine gute Ehrenrettung erschienen, doch in der Sekunde, wo er diese Sätze während des Films tatsächlich laut zu der Person, von der er etwas wollte, gesagt hätte, hätte er vermutlich direkt bemerkt, wie weltfremd, wie unsicher, wie verzweifelt und wie himmelschreiend unsouverän dieser Vorschlag wirkte. Es wäre, dachte die verliebte Person grimmig, während sie dem Film Noir zuschaute, eine völlige Kapitulation meiner Individualität. Ich hätte mich vor der Person, von der ich etwas will, in den Staub geworfen, hätte mich erniedrigt, und zwar nicht bei einem eventuell ja noch irgendwie gerechtfertigen Anlass, sondern aufgrund eines nicht so guten Kinofilms. Er dachte auch daran, dass viele dieser Gedanken während eines Netflix-Abends müßig gewesen wären, da die Atmosphäre eines Netflix-Abends deutlich informeller sei, man deutlich gesichtswahrender einen schlechten Film thematisieren und gegebenenfalls ausschalten bzw. wechseln könne, man generell ohne irgendwie geartete Sanktionierung währenddessen plaudern und Kekse knuspern könnte, und er dachte daran, dass die Person, von der er etwas wollte, sich aber explitit keinen Netflix-Abend gewünscht hatte, sondern einen Kinobesuch, da sie aufgrund der Pandemie schon so lange nicht mehr im Kino gewesen sei, eine große Lust auf diesen Film noir in einem Kino-Setting gehabt hatte, und dass die verliebte Person von dieser Liebe für den Kinosaal einerseits aufrichtig begeistert und eingenommen war (schließlich war die Person auch verliebt), andererseits aber natürlich auch nagende Selbstzweifel ihn überkamen, ob es der Person, von der er etwas wollte, vielleicht weniger um die Liebe für das Kino und umso mehr um eine diskrete, gleichsam gesichtswahrende Absage an einen Netflix-Abend daheim in einer Privatwohnung mit allen damit einhergehenden landläufigen Assoziationen (Sex) ging. Nun jedoch, dachte die verliebte Person, während er auf der Leinwand einer der Hauptdarsteller des Film noir durch eine allegorisch neblig-düstere Straße rennen sah, nun jedoch ist es an der Zeit, all diese Spekulationen sein zu lassen, schließlich sei es nicht so gekommen, dass die verliebte Person und die Person, von der sie etwas will, einen unangenehmen Kinobesuch erleben, sondern tatsächlich schien es gerade ganz gut zu laufen. Die verliebte Person hatte den – wenn auch durch einen bloß mit peripheren Seitenblicken untermauerten - Eindruck, dass die Person, von der sie etwas wollte, interessiert auf die Leinwand blickte, an den richtigen Stellen über die regelmäßig im Film noir auftauchenden sarkastischen Gags gemeinsam mit den anderen Kinobesucher*innen kurz und leise auflachte, und die verliebte Person tat gut daran, es ihm nachzueifern. Allerdings war sie auch stetig bemüht, nicht zeitlich versetzt mit der Person, von der sie etwas wollte, aufzulachen, denn das hätte so gewirkt, als würde sie bloß lachen, weil die Person zuvor gelacht hatte und er sich mit ihr über gemeinsam geteilten Humor verbrüdern wollte. Er versuchte also, stets zeitgleich mit ihm zu lachen, was meistens gut ging, da er den Film gut kannte und wusste, wann und wo welche Art von Gag auftauchen würde. Mitunter kam es auch vor, dass die verliebte Person zuerst aufrichtig lachte oder schmunzelte und dann zu seiner Begeisterung hörte, wie die Person, von der er etwas wollte, neben ihm ebenfalls begann, kurz zu lachen. In diesen kurzen Momenten explodierte das Universum und die Welt wurde elektrisch und warm und nah. Gleichzeitig durfte er auch keineswegs den Eindruck erwecken, dass dies hier mehr sei als ein entspannter sonntäglicher Kinobesuch eines schönen, in Würde und Eleganz gealterten Film noirs; er musste seine Emotionen also in Zaum halten, denn – und dies musste er sich immer wieder vor Augen führen wie eine Mahnung an sich selbst – die Person, von der er etwas wollte, hatte ja explizit bei ihrem allerersten Date im Café verlautbart, dass sie sich erst vor wenigen Wochen aus einer langjährigen Beziehung gelöst habe, nun aber neu in der Stadt angekommen und daher vorrangig auf der Suche nach neuen Freunden sei, diesen Satz habe sie daraufhin nocheinmal wiederholt, auf der Suche nach neuen Freunden und nicht nach einer Beziehung, woraufhin die mittlerweile allerdings in die Person verliebte Person geantwortet hatte, das sei kein Problem, sie sei schließlich auch neu in der Stadt, gemeinsame neue Freunde wären ideal. Daraufhin hatte die die Person, von der er mittlerweile etwas wollte, geantwortet, na das sei doch prima, wobei sie natürlich auch nicht ausschließen könne, dass sie sich nicht irgendwann und vielleicht sogar plötzlich verlieben würde, dass sie im besten Sinne für alles offen sei derzeit, und als er das hörte, fing erstmals für die nun verliebte Person an, alles hell und weit und schön zu werden. Während die nun also mittlerweile verliebte Person sich ermahnte, dass die Person neben ihm zwar nicht zwangsläufig eine Beziehung ausschloss, primär jedoch nur auf der Suche nach gemeinsamen freundschaftlichen Aktivitäten (z.B. einem Kinobesuch) war, und es deshalb wichtig sei, diesen Kinobesuch weniger als Date, und mehr als schlichten Kinobesuch zu verstehen, oder kurz gesagt: dass die verliebte Person dringend damit aufhören sollte, alles auf so extrem fragilie und gleichzeitig so extrem ausschlaggebende Waagschalen zu legen, genug sei schließlich genug und man könne sich jetzt auch endlich einfach mal entspannt zurücklehnen und den Film schauen, da geschah es: die Person, von der die verliebte Person etwas wollte, änderte ihre Sitzposition. Zuerst stellte sie ihre mittlerweile leere Bierflasche auf den Boden, dann kuschelte sie sich etwas tiefer zurück in den Kinosessel und berührte dabei auf einmal und völlig unabgesprochen die Schulter, den Oberarm und kleinere Teile des Unterschenkels der verliebten Person. In dieser neuen Sitzposition verharrte sie nun, der Körperkontakt blieb also bestehen und die verliebte Person rechnete sich direkt aus, dass er nicht bloß anhaltenden Körperkontakt mit einer, sondern gleich zweien seiner Körperextremitäten hatte, das seien 50% der gesamten Körperextremitäten, das sei für das erst dritte Date ein unglaublicher Schnitt, dachte er und trank euphorisch einen großen Schluck Bier aus seiner beinahe leeren Flasche, wobei er tunlichst darauf achtete, sich nicht zu bewegen, damit der Körperkontakt mit der Person, von der etwas wollte, gewahrt blieb. Sein Körper, so viel ließ sich durch die beiden Kleidungsschichten der Personen feststellen, fühlte sich fest und warm und keinesfalls schlecht an. Es wäre jetzt an der Zeit, dachte die verliebte Person, sich von diesem Glücksgefühl nicht allzu kirremachen zu lassen, sondern sich stattdessen in Würde und Lässigkeit auf dem Erfolg auszuruhen, sich also auch einfach ein bisschen in den Sessel zurückzukuscheln (ohne den Körperkontakt zu verlieren, verständlicherweise) und aus dieser schönen, ob nun unabsichtlich oder absichtlich entstandenen Pose heraus den Rest des Films nicht bloß zu schauen, sondern wahrhaftig zu genie��en, und später wäre man nach dem Ende des Films vor dem Kinoeingang, es wäre ein schöner Spätsommerabend, man hätte ein Getränk in der Hand, und der Rest würde sich einfach organisch ergeben, vollkommen organisch, dessen war sich die verliebte Person nun auf einmal sicher, man würde leicht sein und schweben, definitiv, und vielleicht würde die Person, von der die verliebte Person etwas wollte, seine Hand nehmen, vielleicht würde sie es auch bloß antäuschen und nur kurz mit seinen Fingern die Finger der verliebten Person streifen, aber das wäre schon genug, es wäre sogar mehr als genug, es wäre nämlich ein eindeutiges Zeichen, und während sich die milde Nacht über die Stadt senken würde, würden die verliebte Person und die Person, von der sie etwas wollte, langsam und sanft und miteinander sprechend in eine Bar weiterziehen, und auch dort würde sich dann alles organisch ergeben, vollkommen organisch, und so wie er sich das Ende des Abends gerade detailreich ausmalte, wurden der verliebten Person im Kinosessel die Augen etwas feucht vor Hoffnung. Er war nun also mehr als bereit, die vor kurzer Zeit erst getätigten relativierenden Aussagen, dass etwa eine Beziehung ausgeschlossen sei, dass dies bloß ein profan-freundschaftlicher Kinobesuch und kein Date sei, wieder komplett zu überwerfen, schließlich saßen sie nebeneinander und berührten einander – an der Schulter, am Oberarm und an kleineren Teilen des Oberschenkels. Der Körperkontakt war nun mittlerweile schon länger aufrecht erhalten, sicherlich eine Minute oder mehr, so dass allmählich allerdings bei der verliebten Person die Frage aufkam, ab wann dieser Körperkontakt sich vielleicht nicht mehr organisch und sich einfach natürlich anfühlen würde, sondern eventuell etwas gestelzt oder gar forciert. Ab wann, dachte die verliebte Person nun plötzlich wieder besorgter werdend, hört dieser Körperkontakt auf, sich normal anzufühlen und wird plötzlich seltsam? Die verliebte Person fragte sich, nun plötzlich nicht mehr bloß besorgt, sondern bereits am Rande der Angst, ob die Person, von der er etwas wollte, vielleicht in Wahrheit es mehr als seltsam fand, dass die verliebte Person den Oberarm und Oberschenkel nicht anders positioniert hatte bei Beginn des Körperkontakts – so, wie man es ja beispielsweise auch in einem vollbesetzten Zug oder bei einem Büro-Meeting tun würde: man würde den Körperkontakt merken, und daraufhin als vereinbartes soziales Ritual unter Menschen die Extremitäten wieder ein bisschen anders positionieren, um ihn aufzulösen. Das ist schließlich die fest vereinbarte Regel in der westlichen Welt: jede Körperlichkeit zwischen Menschen ist fest in feinfiletierte Handlungsparameter eingeteilt. Die verliebte Person war daher nun, nicht mehr bloß ängstlich, sondern sich am Rande der Panik befindlich, nicht mehr sicher, ob ihn die Person, von der er etwas wollte, also in Wahrheit vollkommen creepy fand – wie er dasaß, in seinem Kinosessel, und es überhaupt nicht beachtenswert fand, dass man sich nun schon seit über 90 Sekunden berührte. Was, dachte die verliebte Person nun vollends panisch, wenn es nicht bloß unangenehm und weltfremd wirkt, wie ich diese Bewegung vollkommen entspannt aushalte, sondern eventuell sogar vollkommen soziopathisch? Wirkt es eventuell so, dachte sie, als würde ich die Grundregeln minimaler sozialer Interaktionsrituale nicht beherrschen? Ist es nicht das, was sie in Reportagen auch immer über Psychopath*innen oder Narzisst*innen berichten, fragte sich die verliebte Person. Er kam also nach diesen Gedanken zu keinem anderen Schluss als zu dem, dass er den Körperkontakt – obwohl er ihn ja so sehr wollte, er sich so darüber gefreut hatte, er sich zu Beginn des Kontakts erstmals hätte ernsthaft entspannen können – würde abbrechen müssen. Er würde sich im Kinosessel fundamental anders positionieren müssen, damit er in den Augen der Person, von der er etwas wollte, weder wie ein Psychopath noch wie ein übermäßig triebgesteuerter Freak wirkte, der ausgehungert nach Berührungen und menschlichem Kontakt zu sein schien. Stattdessen würde er sich so hinsetzen müssen, dass er total unabhängig wirkte – also am Besten eine komplett neue Sitzposition, sich vielleicht mehr nach vorne beugend, um vom Kinofilm äußerst engagiert und gut unterhalten zu wirken. Das wäre einerseits ein starkes nonverbales Plädoyer für die Qualität des Film noirs und würde das Cineastentum der verliebten Person unterstreichen, was der Person, von der er etwas wollte, sicher gefallen würde, andererseits würde es auch klar signalisieren, dass er sich aus Körperlichkeit bei diesem Abend nicht so viel machte, es sei ja bloß ein rein platonischer Kinobesuch, alles halb so wild, und wenn sich mehr draus ergeben sollte, könne man der verliebten Person somit nun wirklich nicht vorwerfen, dass sie darum verzweifelt gebettelt habe mit möglichst anschmiegsamen Körperkontakt. Die verliebte Person war von dieser souveränen Lösung somit also begeistert, obwohl sie auch eine Sorge hatte, dass das radikale Umsetzen im Kinosessel eventuell etwas brüsk wirken könne – vielleicht würde es gar nicht mal so souverän, so kunstbeflissen und so sexy-unnahbar wirken, sondern vielmehr als wäre er von der Person, von der er etwas wollte, abgeturnt, geradezu angeekelt vielleicht. Würde es nicht wie eine eindeutige Rote Karte wirken, fragte sich die verliebte Person. Vielleicht würde es so wirken, als würde die verliebte Person von der Person, von der die verliebte Person etwas wollte, gar nichts wollen. Das war also auch keine Lösung, war sich die verliebte Person sicher, und entschied sich daher in ihrer Not wie so oft für einen Kompromiss: sie würde den Körperkontakt am Bein halten, allerdings Oberarm und Schulter neu bewegen, in dem sich der Oberkörper der verliebten Person diagonal in die andere Richtung des Kinosessels strecken würde. Diese Pose war zwar auf Dauer sicherlich unbequem, aber wirkte immerhin nicht lächerlich. Zwar merkte er, wie sein linkes Bein allmählich einschlief und er also besser jenes hätte bewegen sollen, aber nun war es zu spät. Hauptsache, man hat die Situation derartig prägnant deeskalieren können. Er war erleichtert über seine rasche Entscheidungsfreude und lachte daher über den nächsten kleinen Gag im Film noir vielleicht etwas zu laut, und erstmals während des Kinobesuchs war ihm etwas vollkommen egal. Nach dem Film noir gingen sie dann übrigens noch in eine nahgelegene Bar, wo die verliebte Person zuerst ihr Cocktailglas umschmiss und sich später noch komplett um Kopf und Kragen redete.
Geschrieben im September 2020 und Februar 2021. Based on a true story.
2 notes
·
View notes
Text
Farbe ohne Körper
“denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht” (Rainer Maria Rilke)
“Blue protects white from innocence. Blue is darkness made visible.” (Derek Jarman)
“ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut / in der wir untergegangen sind” (Bertolt Brecht)
Als ich 16 Jahre alt war, sah ich einen Film, der ausschließlich aus einer einzigen Einstellung bestand, und diese Einstellung war die Farbe Blau. Auf ihn aufmerksam geworden war ich durch den Flyer eines kleinen Programmkinos in Münster, das mein Französischkurs alljährlich im Frühjahr besuchte, um dort einen französischen Film zu sehen und direkt danach wieder heimzufahren. (Den Großteil der Filme habe ich schon wieder vergessen, aber in dem Jahr, als ich im Flyer des Programmkinos erstmals von dem Film erfuhr, der bloß aus ununterbrochenem Blau bestand, sahen wir dort Sie küßten und sie schlugen ihn von François Truffaut. Der Truffaut-Film blieb so sehr im Gedächtnis, dass ich mir noch Jahre später eine Flasche Milch kaufte und mit ihr an meiner Seite nachts eine fremde Stadt durchstreifte, doch nichts daran fühlte sich so erhaben und wild an, wie es sich augenscheinlich für Jean-Pierre Léaud im Film anfühlte, es fühlte sich in Wahrheit sogar recht trostlos an.)
Der Film, der einzig und allein aus blauer Farbe bestand, hieß schlicht Blue und ich fand damals auf YouTube einen kleinen Ausschnitt, nur ein oder zwei Minuten lang und mit italienischen Untertiteln. Es wirkte auch mehr wie ein Hörspiel als ein Film: da, wo in der Bildspur die blaue Farbe unwidersprochen allein regierte, da tummelten sich auf der Tonspur zahllose Geräusche, immer wieder aufbrandende und abebbende Musikfetzen, Klänge, ein Chor verschiedener Stimmen (erst später, durch das Sehen anderer Filme, kamen mir zu den Stimmen deren prominente Gesichter hinzu: Tilda Swinton, Nigel Terry, ...). Blue, las ich in dem Kinoflyer, war der letzte Film des britischen Filmemachers und Malers Derek Jarman. Ein Film, der sechs Jahre nach Jarmans HIV-Diagnose und ein Jahr vor seinem Tod veröffentlicht wurde, zu einem Zeitpunkt, an dem Jarman aufgrund der Erkrankung schon einen Großteil seiner Sehkraft verloren hatte. Die ihm verabreichten Medikamente verlängerten sein Leben um einige Monate, tauchten seine Netzhaut allerdings in hellblaue Farbe.

Vielleicht ist Blue so atemberaubend, weil es Dokument einer Vergänglichkeit ist: jede Sekunde des majestätisch thronenden Blaus verrät schon die Schwärze, die unausweichlich folgen wird. Und gleichzeitig ist es ein Lebenszeichen, getaucht in die unermesslichen blauen Weiten des Wassers, des Himmels, der Kornblumen und Schwertlilien. Das monochrom leuchtende Ultramarinblau wird weniger zum Symbol für Krankheit und Symptom, sondern stattdessen zur Blaupause ( ja, doch!) und zur leeren Leinwand für all die möglichen und unmöglichen Bilder, die dieser Film zu erzeugen weiß – wenn auch nur in den Köpfen der Zuschauer. Der Film ist die Beschreitung des langen Weges in die glückliche Zone des Immateriellen und Zeitlosen, des Bereits-Verlöschten und des Noch-Nicht-Aufgeflammten, vorbei an der Wettergrenze zwischen Frohsinn und Elegie. Dass Blue in bloßer blauer Farbe versinkt, macht aus dem Film eine alchemistische Umwandlung: Bilder werden zu Blau, Blau wird zu Bildern. Persönlichkeit löst sich auf, Film löst sich auf, Kunst löst sich auf, Leben löst sich auf. Jede visuelle Repräsentation, jedes Abbild schwindet. Zurück bleibt bloßes Blau. »In the pandemonium of image«, sagt Jarman an einer Stelle des Films, »I present you with the universal blue.«
Der Text des Films besteht aus Tagebucheinträgen Jarmans, aus hymnischen Versen an die Farbe Blau, aus Lebenserinnerungen. Die vielleicht manchmal etwas blümeranten Verse wechseln sich ab mit dem harten Krankenhausalltag eines Menschen, der an Immunschwäche sterben wird: das Singen des Tropfes im Arm, all die Antibiotika, die man auf der Toilette wieder auskotzt, die genaue Beschreibung der Körper, die innerhalb nur weniger Monate und Jahre in der Mitte ihres Lebens zu kaum mehr wiedererkennbaren Gerippen werden. Stets im klaren Bewusstsein darüber, dass es nicht nur ihm so geht, sondern seiner gesamten Generation, der gesamten schwulen Szene des Landes, seinem gesamten Freundeskreis. »Ich laufe während eines heulenden Sturms den Strand entlang«, heißt es zu Beginn des Films. »Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu und in der schäumenden Gischt höre ich die Stimmen toter Freunde. David. Howard. Graham. Terry. Paul.« Wie haben sie den kobaltblauen Fluss überquert, was zahlten sie dem Fährmann?
Mein Onkel starb im Sommer 1992 an AIDS und ich weiß fast nichts über ihn. In meiner Familie hat man sich anscheinend dazu entschlossen, nicht darüber zu sprechen. Ich weiß, dass er mit meiner Familie auf unserem Hof lebte. Meine drei Geschwister haben ihn allesamt noch kennengelernt, ich wurde erst 1993 geboren. Es gibt nicht viele Fotos von ihm. Ein Foto aus dem Herbst 1989 zeigt ihn auf einer Wiese neben meiner Tante auf einer blauen Wolldecke liegen, die beiden wurden von oben fotografiert. Meine Tante schaut in die Ferne, nur mein Onkel schaut verschmitzt lächelnd und mit zugekniffenen Augen in die Kamera. Ich sehe sein weißes Hemd, seine blaue Jeans vor mir und seinen buschigen Oberlippenbart. Ich habe mir dieses Foto lange angeschaut und immer wieder gehofft, dass mein Onkel mit mir sprechen könnte, etwas über sich verraten könnte. Dass er mir durch das Betrachten des Bildes etwas über sein Leben preisgeben würde. Doch das Foto schweigt und so weiß ich fast nichts über ihn. Ich gebe zu, und das ist schwierig auszuhalten, dass ich ein paar Sekunden überlegen musste, bevor mir sein Name einfiel: Hans-Josef. Mein Onkel hieß Hans-Josef. Ich weiß nicht, wo in meinem Elternhaus er sein Zimmer hatte. Ich weiß nicht, wie und wann er sich infizierte und ob er einen festen Partner hatte. Ich weiß nicht, wie er es meinem Vater oder seiner Mutter, meiner Großmutter, erzählte, dass er HIV-positiv sei und wohl sterben würde. Ich weiß nicht, wie seine Krankheit verlief. Ich weiß nichts von seinen letzten Wochen und Tagen. Ich weiß nur, dass Hans-Josef auf unserer Friedhofsparzelle bestattet liegt, neben meiner Oma und meinem Opa. Und erst mit 19 habe ich auf dem Friedhof von meiner Mutter erfahren, woran Hans-Josef, dessen Name so selten in unserer Familie erwähnt wird, als hätte es ihn nie gegeben, wirklich starb. Dass er schwul gewesen sei. Und dass es für meinen Vater eine sehr schwere Zeit gewesen sei. Die Vorstellung, dass Hans-Josef noch leben könnte, und mir ein Begleiter hätte werden können, zerreißt mir das Herz. Dass er mich nie kennengelernt hat, dass wir keine einzige geteilte Sekunde Existenz auf dieser Erde hatten. Ich weiß nicht, wieso es mich so traurig macht. Aber ich schreibe diese Sätze mit Tränen in den Augen.
1993, im selben Jahr, in dem Blue erscheint, malt Derek Jarman mit Hilfe seiner Assistenten das 2,5 × 1,7 m große Gemälde Ataxia – Aids is Fun. Bunte Streifen hastig und rauschhaft wilder auf die Leinwand gewetzter Ölfarbe (gelb, grün, hellblau) auf rotem Grund, dazu in dieses Farbenchaos mit Hand geschriebene Sätze, auf den ersten Blick kaum entzifferbar: Blind Fail. Ataxia. Aids is Fun. Let’s Fuck. Ich versuche, schreibt Jarman in sein Tagebuch, die Wut rauszulassen, die jeder Infizierte fühlt. Das Körperliche, das Ausagierende des Malens lässt mich die Aggressionen abbauen. Wo Blue in seelenschwerer visueller Transzendenz verweilt, ist dieses Gemälde geradezu verstörend roh, farbenfroh, vulgär. Auch andere Gemälde aus der Zeit (namens Arse Injected Death Syndrome oder Dead Sexy) wirken gespenstisch: trotz der unmittelbaren Nähe zum Tod geht von diesen Bildern eine irrlichternde Party-Atmosphäre aus. Als hätten sich all die Freunde zum Totentanz im Club getroffen. Es ist halt so, wir Menschen lieben morbide Geschichten und noch mehr lieben wir das Narrativ des sich quälenden Genies, das sich in seinen letzten Wochen und Tagen für die Kunst verausgabt, bis an den Rand des körperlichen Verschwindens. Wir können keinen Text über Blue schreiben, ohne zu erwähnen, wie Derek Jarman sichtlich todkrank die Filmpremiere auf sich nahm, sogar noch zu einigen Filmfestivals reiste und aufgrund der Erschöpfung beinahe daran gestorben wäre. Wir müssen lesen, wie der Film ein Sterbefilm, ein Memento Mori, ein künstlerisches Testament ist, sonst verlieren wir das Interesse. Wir müssen die radikale Ehrlichkeit Derek Jarmans bewundern, der sein Sterben und das Sterben seiner Freunde offenlegte, sonst ängstigt sie uns. Ich meine das nicht bösartig oder zynisch, es ist nur einfach so, wir Menschen lieben solche Geschichten.

Als ich mich bei meinen Eltern oute – mit erst 22 Jahren –, muss ich immer und immer wieder an Hans-Josef denken. Zwar nahmen meine Eltern das Outing halbwegs gut auf (meine Mutter sagte, mein Vater hätte eine schlaflose Woche gehabt, und danach sei alles so gewesen wie vorher), doch ich merke, wie das Phantom, die Abwesenheit meines Onkels durch unsere kurzen Gespräche zu dem Thema spukt. Jedes Mal am Telefon wird mir seitens meiner Eltern eingebläut, dass ich mich unbedingt schützen müsse, und ihnen verdanke ich es wohl, dass ich mich nach jedem meiner ersten sexuellen Kontakte nach dem Outing – egal, wie geschützt oder wie ungefährlich – dabei ertappte, mich über jede noch so unbedeutende Hautrötung oder jeden noch so kurzen Juckreiz bis aufs Mark zu erschrecken. 2015, während meines Auslandssemesters in Athen (vielleicht brauchte ich die räumliche Distanz nach Hause, wer weiß) packt mich die Trauer über Hans-Josef aus heiterem blauem Himmel und ich weine einen gesamten Abend lang wie ein Kind, dass ich niemanden meiner Eltern, meiner Brüder, meiner Schwestern, meiner Tanten und Onkel zu ihm befragen kann, dass er mir in meinem Leben fehlt, dass er mir ein Vorbild hätte sein können, ein lebender Beweis, dass man auch im Westmünsterland am Ende der Welt hätte schwul sein können. Auf den Rückflug von Athen nach Deutschland, für die Weihnachtsferien, schaue ich erstmals seit dem Abend als Teenager mit dem kleinen, italienisch untertitelten Ausschnitt auf YouTube Blue von Derek Jarman – diesmal in gesamter Länge. Und während unter einer Wolkendecke der europäische Kontinent dahingleitet, höre ich die letzten Sätze des Films: »No one will remember our work. Our life will pass like the traces of a cloud, and be scattered like mist that is chased by the rays of the sun. For our time is the passing of a shadow and our lives will run like sparks through the stubble. I place a delphinium, Blue, upon your grave.«
Schon in den späten 1970ern, also lange vor seiner HIV-Infektion, plante Derek Jarman den Film Blue. Der Prototyp sollte ebenfalls ein unveränderlich blaues Bild zeigen, die Tonspur aber eine assoziative Hommage an den französischen Künstler Yves Klein werden, der in den 50ern mit der von ihm geschaffenen Farbe International Klein Blue große Erfolge feierte. Sicherlich würde niemand mehr über diese ursprünglich geplante, harmlose Yves Klein-Hommage heute noch ein Wort verlieren, so wie niemand mehr heute Worte verliert über die Abermillionen gut gemeinter und gut gemachter Kunstfilme aus den 80er Jahren, die uns so fern wirken als falle ihr Licht nicht von einer Leinwand auf unsere Netzhaut, sondern von einem Lichtjahre entfernten Stern am uns gegenüber liegenden Ende der Milchstraße. Was wäre es heute vermutlich für ein atemberaubend langweiliger Film, verstaubt und vergessen in irgendwelchen Archiven lagernd, immer mal wieder als Leihgabe in irgendwelchen Yves Klein-Ausstellungen als Screening vor sich hindudelnd in einem dieser Ausstellungsräume, wo man immerzu nach einer Minute schon wieder aufsteht, weil’s irgendwie doch nicht so spannend ist. Oh, was für ein egaler Film es vermutlich heute wäre. Ein reines Formexperiment, aus der Zeit gefallen und wie eine schlichte Avantgarde-Stilübung.
Doch – und dieses Doch ist größer als die Galaxie – wenn Blue ein vielleicht heutzutage vergessener Film über Yves Klein geworden wäre und keine Auseinandersetzung mit dem sich nahenden Sterben, dann würde das heißen, dass Derek Jarman nie an AIDS gestorben wäre. Dann würde er jetzt noch leben. Sein Herz würde noch schlagen. Seine Augen würden noch sehen. Er würde jetzt, in diesem Moment noch, hören und fühlen können. Derek Jarman könnte jetzt in den weiten, hellblauen Himmel über sich schauen und sich in einem gedankenleeren Moment daran erinnern, dass er mal einen Film gemacht hatte, der die Schönheit ebendieser Farbe zu erzählen versuchte. Der in Wahrheit am 19. Februar 1994 im Londoner St. Bartholomew’s Hospital gestorbene Derek Jarman würde heute noch hier sein, bei uns, und vielleicht würde er noch Filme machen und wir würden sie sehen, und all das Leid hätte nicht sein müssen, und all das Sterben hätte nicht sein müssen, und all die Tränen und all das Stigma und all das Schweigen und all die Wunden hätten nicht sein müssen, und es wäre bloß ein Film und blaue Farbe.
Juni 2018. | Danke sagen
Dieser Text ist Teil der blauen Anthologie von Leon Lukas Plum.
11 notes
·
View notes
Text
An einer winzigen Biegung eines gigantischen Flusses
Es wird der Zweck aller Naturbeschreibung am leichtesten erreicht durch Einfachheit der Erzählung von dem Selbstbeobachteten, dem Selbsterlebten, durch die beschränkende Individualisierung der Lage, an welche sich die Erzählung knüpft. (Alexander von Humboldt: Das nächtliche Tierleben im Urwalde.)

Jedenfalls, so heißt es übereinstimmend in den noch erhaltenen Dokumenten und Berichten der Expedition, fiel Meyer am zweiten Tag nach der Verletzung gegen Anbruch der Dämmerung ins Fieber. Burckhardt beschreibt, wie die Mannschaft den im Delirium liegenden Meyer behutsam an den Bug des Floßes legte und wie er dort zitternd und Unverständliches murmelnd auf den sich hinter ihnen kräuselnden Amazonas blickte, der in der Abendsonne so dunkelgrün funkelte wie ein hässlicher Diamant. Es galt, Zeit zu gewinnen und so wollte man das gute Dutzend Seemeilen flussaufwärts ins Landesinnere rasch hinter sich bringen. Dort vermuteten die Expeditionsteilnehmer noch eine alte europäische Missionarssiedlung, in den Landkarten war ein Kreuz eingezeichnet, ein oder zwei Jakobinermönche würden gewiss noch am Leben sein. Vielleicht besäßen sie noch ein wenig Arznei oder zumindest ein scharfes Beil, mit dem sich der Unterschenkel würde amputieren lassen.
Laut Burckhardt sei Meyer humpelnd aus dem Unterholz hervorgekommen, mit viel Brennholz für das Lagerfeuer und einem scharfem Eisenpfeil, der den Unterschenkel einmal komplett aufspießte. Über Schmerzen klagte er kaum, nur äußerte er Bewunderung für die so unauffällige und effektive Tierfalle der Eingeborenen, der er zum Opfer gefallen war. Als Gussholdt ihn darauf ansprach, dass so eine Verletzung hier am äußersten Ende der ihnen bekannten Welt gewissermaßen ein Todesurteil darstelle, blickte Meyer bloß in das Feuer und sagte: "Das ist gewiss deprimierend, sehr deprimierend sogar." Man betete pflichtschuldig, gab ihm Schlafmohn-Extrakt gegen die Schmerzen, und hoffte auf den Sonnenaufgang.
Am Tag vor der Verletzung hatten sie erstmals einen Eingeborenen getroffen. Sie hatten am Ufer Rast gemacht und einige der Bromeliengewächse in den hellgrünen Botanisiertrommeln verstaut, als Wörderhoff, der jüngste Expeditionsteilnehmer, einen Pfad in das Dickicht entdeckte. "Der Pfad sieht menschengemacht aus", sagte er und so folgte man ihm, bis man sich einer kleinen Siedlung näherte. Wenige Basthütten, ein erschöpft von sich hin glimmender Feuerplatz, eine modrige Wassersenke und bis auf einen uralten Mann, der am Feuer saß, keine einzige Menschenseele. Vielleicht waren die anderen Eingeborenen zur Jagd, vermutlich hatten sie aber die Siedlung aufgegeben und den Alten allein zurückgelassen, denn den Letzten bissen am Amazonas die Hunde. In der europäischen Pionier- und Missionarsliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts finden wir zahllose Belege, dass die Eingeborenen im Amazonasgebiet Altruismus angeblich nicht verstanden hätten. Wir wollen uns hüten, aus heutiger Perspektive darüber zu urteilen, doch auch Burckhardt schreibt in dem uns vorliegenden Expeditionsbericht, wie der Alte am Feuer es seelenruhig hinzunehmen schien, dass er ganz allein ohne Verpflegung in einer Geisterstadt hockte und nun drei wildfremde Europäer sich ihm näherten, die eine Sprache sprachen, die für ihn wie gottloser Papageiengesang klingen musste, oder wie etwas, für das es in unserer Sprache kein Wort gibt. Man sprach ein wenig Deutsch mit ihm, was er selbstredend nicht verstand. Man zeigte ihm sein Gesicht in einem Spiegel, was ihn nicht so sehr zu beeindrucken schien. Man gab ihm eine Kartoffel in die Hand, was ihn gähnen ließ. Ratlos standen die Expeditionsteilnehmer um diesen stillen und fernen Mann herum, der da bloß mit Lendenschürz vor ihnen in der Asche hockte und gleichmütig in das grüne Dickicht hinter ihnen blickte. "Vielleicht ein Schamane", meinte Meyer. "Vielleicht einfach auch bloß eine große Falle", meinte Gussholdt. Man las ihm das Vaterunser vor und den 23. Psalm. Sie waren gerade bei dem Vers "Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher" angelangt, da sagte er eine Silbe, die keiner verstand. Man legte das Gebetsbuch zur Seite und starrte ihn an. Er wiederholte die Silbe ein paar Mal, fügte bei jedem Wiederholen einen weiteren kurzen Laut hinzu, und erst nach einer Zeit, so Burckhardt in seinem Bericht, fiel bei ihnen allen der Groschen, dass er drei englische Wörter sagte. Immer und immer wieder sagte er sie, zwar langsam und mit einem schweren Akzent, doch sie waren unverkennbar Worte der englischen Sprache: "dark and away". Wörderhoff fragte ihn auf Englisch, ob er Englisch spräche, doch der Alte sagte bloß: "dark and away." Wörderhoff fragte ihn auf Englisch, ob er das Wort Gottes empfangen habe und ehre, doch der Alte sagte bloß: "dark and away." Wörderhoff fragte ihn auf Englisch, ob die britischen Missionare, die ihm zweifelsohne eines Tages mal die Worte beigebracht hatten, auch die großen Tragödien eines Shakespeare oder die Verse eines William Blake oder, naja, zumindest eines Lord Byron nahegebracht hätten, doch der Alte zeigte auf seine Brust und sagte bloß: "dark and away." Und er sagte es so langsam, so müde, und vielleicht auch so mutterseelenallein, dass es einem fror, schreibt Burckhardt, was wir als heutige Leser so hinzunehmen haben. Und danach starrte er bloß milde lächelnd in den grauen, schwülen Himmel über ihnen und sagte überhaupt nichts mehr, so sehr die Expeditionsteilnehmer ihn auch baten. Verwirrt ließen sie ihm etwas Obst und Wasser da, verließen die Siedlung und sahen ihn nie wieder.
Das Fleisch um Meyers Verletzung hatte sich purpurn entzündet, und alternierend fiel Meyer in tiefen, totenähnlichen Schlaf und dann wieder in fiebernden Wahn. Vielleicht würde er die Nacht nicht überleben, so sehr man ihn auch mit kühlem Wasser des Amazonas übergoss. An Schlaf war nicht zu denken, notiert Burckhardt im Bericht. Der ungerechte Kampf Meyers gegen den sich nähernden Tod nahm die Expeditionsteilnehmer zu sehr gefangen, außerdem waren die Heuschrecken zu laut und ein Moskitoschwarm folgte ihrem Floß treu durch die mondlose Nacht. Es findet sich an dieser Stille in Burckhardts Bericht der rätselhafte Satz "der fluß dampft, als sei er brünftiges fell" und vielleicht war die Schlaflosigkeit der Grund für solch abenteuerliche Metaphern. Generell spiele die Fremde und das Nicht-Aufgehoben-Sein in einer Welt dem Menschen bösen Schabernack, schreibt Burckhardt weiter. Er berichtet, wie sehr Gussholdt oder selbst der junge, rothaarige Wörderhoff im Laufe der Expedition sichtlich gealtert seien. Und der meist eher stille Dornberg, ein Hafenarbeiter und später angeheuert bei der Königlichen Marine, sagte oft selbst, wie gealtert er sich fühle und dass er sich anschicke, "von alldem hier Abschied zu nehmen, Abschied zu nehmen...", während er mit der Hand wehmütig auf die dunkelgrünen Schmetterlinge auf der Reling des Floßes deutete.
Es war früher Morgen, als sie die alte Missionarssiedlung fanden, die sich hinter den über dem Wasser schwebenden Baumkronen verbarg. Vier karge Hütten, ein kleines Lehmgebäude mit einem großen weißen Kreuz als provisorische Kapelle. Man legte am flachen Ufer an. Meyers Temperatur war ein wenig gesunken, schien es, und mit starrem Blick schaute er auf den sich langsam erhellenden Morgenhimmel über sich. Dabei wisperte er langsam etwas, immer und immer wieder wiederholend, wie jemand, der ein Gedicht oder eine Adresse auswendig lernen müsse oder eine schwierige Multiplikations-Aufgabe im Kopf Schritt für Schritt zu lösen habe. "Die Welt", flüsterte Meyer in die Morgenluft hinein, "die Welt. Die Welt besteht. Die Welt. Die Welt besteht. Die Welt besteht aus Sauerstoff. Die Welt besteht aus Sauerstoff. Die Welt besteht zu siebzig Prozent aus Sauerstoff. Die Welt besteht zu siebzig Prozent aus Sauerstoff und Traurigkeit." Dies war der letzte verständliche Satz Meyers, zwölf Stunden später war er tot.
Tatsächlich lebten sogar noch drei deutsche Missionare in der Siedlung: Wägele und Meinhold, zwei Missionare aus der Nähe von Stuttgart, sowie deren ehemaliger Assistent, Rincke, der ursprünglich aus Westfalen stammte und sonst nichts sagte. Seit sicherlich mehr als einem Jahr hatten sie keine Europäer mehr gesehen, sagten sie, wobei das mit der Zeitmessung schwierig sei, ihnen seien alle Chronometer kaputt gegangen wegen der Luftfeuchtigkeit und die Kalender seien nur noch schmückendes Beiwerk ihrer schnöden Basthütten. "Morgens geht die Sonne auf und abends geht sie unter. Meistens regnet es, manchmal regnet es nicht. Mehr muss man eigentlich nicht wissen", sagte Wägele im breiten Schwäbisch und die Expeditionsteilnehmer nickten bloß, denn sie wollten Wägele nicht offenbaren, dass sie ihn in Wahrheit für einen mittlerweile anscheinend vollkommen verwilderten Irren hielten. Es werde also auch am Sonntag keine Messe mehr abgehalten? "Nein", sagte Meinhold, "ohne Gemeinde kein Pastor. Eingeborene gibt es hier im Umkreis von mehreren dutzend Meilen keine mehr." Die von ihnen erwähnte aufgegebene Siedlung mit dem alten Mann am Feuer müsse ein Irrtum sein, sagte Meinhold, sicherlich hätten sie sich geirrt oder wollten die drei Missionare auf den Arm nehmen, worüber sie mal gnädig hinwegsehen würden. "Wir ernähren uns von dem, was uns der Wald reichlich schenkt. Wir sind sogar recht gut im Fischfang. Nur baden sollte man im Amazonas nicht, hier wimmelt es vor galvanischen Aalen und Caribito-Fischen. Der Caribito fällt die Menschen beim Baden oder Schwimmen an und beißt ihnen oft ansehnliche Stücke Fleisch ab. Gießt man bloß ein paar Tropfen Blut ins Wasser, so kommen sie zu Tausenden herauf. Und der galvanische Aal löst im Schwimmer Muskelschwäche aus, Schmerz in den Gelenken, allgemeine Übelkeit. Wir waschen uns daher bloß mit Regenwasser." Tatsächlich verbrächten die Missionare viel ihrer Zeit damit, am Amazonas zu sitzen und in das endlose Treiben des Wassers zu starren. "Die Natur erlaubt uns hier manchmal das seltsame Schauspiel der schwarzen Wasser", erwähnte Wägele. Tatsächlich färbt sich das Wasser im Amazonasbecken beizeiten kaffeebraun, im Schatten der Palmenbäume geht der Farbverlauf in Tintenschwärze über. Anfangs sei alle paar Monate noch ein schwarzhölzernes französisches Gesandtenboot mit großen Schiffskisten voller Zwieback und unentwegten Beteuerungen gekommen, die drei Missionare zurück nach Europa zu bringen, aber damals glaubte man noch daran, dass der Herr die Pfade der Eingeborenen schon noch in ihre Richtung lenken würde, und man sagte den Franzosen ab: "Non, merci, désolé." Irgendwann überließ man die drei Missionare wohl ihrem Schicksal, auf jedem Fall kamen die Franzosen nie wieder, vielleicht habe ja auch Frankreich mittlerweile aufgehört, zu existieren. "In den ersten Monaten danach wurden wir wahnsinnig, inzwischen sind wir wieder normal", sagte Wägele freundlich und biss in eine gelblich-grüne Frucht, die nach Kaminruß roch.
Burckhardt berichtet, wie er Wägele und Meinhold von Meyers Unglück erzählen wollte, doch sie unterbrachen ihn: "Wie er sich verletzt hat, ist völlig unwichtig. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das hat man in der Sekunde, in der es passiert, meist schon wieder vergessen." Sie zogen ihm den Eisenpfeil aus dem Unterschenkel, ein großer rotbrauner Klumpen Blut und ein bisschen Eiter proff aus der Wunde und Meyer schrie, bis er ohnmächtig wurde. Meinhold hielt einen Säbel in das kleine Ofenfeuer, mit dem er am selben Abend Meyers Leichenschmaus zubereiten würde, und als er notdürftig desinfiziert war, gab er ihn Rincke und dieser trennte das Bein Meyers knieabwärts vom Körper Meyers ab. Natürlich starb Meyer kurze Zeit später. Die Entzündung hatte schon seinen gesamten Leib vergiftet, aber der Blutverlust durch die Amputation war ja auch nicht von schlechten Eltern. Man bestattete ihn in der feuchten, weichen Erde und rammte ein kleines bronzenes Kreuz auf die Grabstätte; Gussholdt und Dornberg weinten ein wenig. Über dem Grabe rauschten die Palmen. Die beiden Missionare schienen sich zu freuen, doch mal wieder ein Begräbnis abhalten zu dürfen und Wörderhoff hielt auch auf ihre Bitte hin eine Grabrede, die von Burckhardt dokumentiert wurde - allerdings in einer solchen Detailliertheit und Länge, dass sich in der Forschungsliteratur schon mehrfach die Frage gestellt wurde, ob es sich hier um die echte transkribierte Trauerrede handle, oder eher um eine nachträglich komponierte, sinngemäße Wiedergabe aus dem Gedächtnis Burckhardts oder der Missionare. Mögen wir nichtsdestotrotz nun einen Schimmer des Augenblicks lang Meyer und seiner treuen Forschungskumpanen gedenken und daraufhin einen Blick hineinwagen in diese Trauerrede, die da vermeintlich eines schwülen Vorabends vor knapp 200 Jahren in einem anderen Erdteil, in einer uns fremden Zeit gehalten wurde, an einer winzigen Biegung eines gigantischen Flusses und unter unerbittlichem Grün.
Wörderhoff sprach: "Wir nehmen heute Abschied von Ignaz Meyer, geboren und aufgewachsen in Göttingen, gestorben durch schieres Pech am Amazonen-Strom im Kaiserreich Brasilien. Was für eine Person Ignaz Meyer war, das ist mir kaum geläufig. Gewiss sprach man mit ihm ein wenig über seinen Werdegang: dass er daheim in Deutschland Vorlesungen an renommierten Universitäten gehört hatte, dass er Alexander von Humboldt einmal die Hand geschüttelt und dieser bloß "Aufrecht, Bursche, aufrecht!" zu ihm gesagt habe, dass er gern die Violine spielte und Pfeife rauchte, dass er ein großes Talent für die Pflanzenkunde besaß, und dass ihm Gott nicht fremd war, er aber seine Zweifel hatte mit der Unsterblichkeit der Seele und der Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Nun, das muss er jetzt selber für sich herausfinden. Ich weiß ehrlich gesagt manchmal, wenn ich das Singen der Tukane in den grünen Zweigen höre, auch nicht mehr, was oder ob ich glauben soll. Diese Gegend macht was mit einem. Wenn ich daran denke, was für ein Mensch ich war, bevor ich hier hinkam, dann erschaudere ich schon ein wenig. Damals war ich noch Student in München, und hätte ich nicht eines Tages an der Wand vor dem Karzer einen Aufruf zur Atlantik-Passage gesehen, als Assistent einer gutbezahlten Forschungsmission im Amazonenbecken, dann läge ich vermutlich jetzt im Englischen Garten oder ich schwämme in der Isar, oder ich würde mit meinen Freunden Tabak rauchen. Aber nein, ich dachte, ich folge dem Spannenden, dem Ungewohnten, hinaus in die Neue Welt und jetzt bin ich hier und beerdige einen Einbeinigen, den ich kaum kannte, unter Fächerpalmen, die mir nichts bedeuten, nahe eines Flusses, der mir nicht behagt, in einem Glauben an die Wissenschaft, der mir vielleicht so entwischt ist wie die Forelle dem Kescher meiner Freunde beim Fischen in der Isar. Das alles hier ist sicherlich ungewohnt, und das ist sicherlich auch spannend, sicherlich neu, aber vieles daran fühlt sich auch sehr, sehr einsam an. Und ehrlich gesagt geht einem der ganze geraunte Heroismus auf kurz oder lang ziemlich auf den Wecker. All dieses stete Beteuern, wie sehr diese neue Kargheit des Herzens das Leben stärke. All dieses stete Gerede, wie man die fremde, feindliche Gegend sich schon unterjochen oder sich, zumindest, zum Freunde machen könne. All das stete Geglaube, dass man schon hier rausfinden würde, ohne völlig gebrochen, traurig oder verunstaltet die Heimkehr anzutreten. All das stete Hoffen, dass es die Heimkehr überhaupt geben wird. Wieso soll ich denn glauben, ich wolle mir überhaupt diese Gegend unterjochen oder zum Freund machen? Ich möchte keine Gegend zum Freund haben, in der riesige abgewetzte graue Eulen mit gigantischen Flügeln und grausig menschenähnlichen Köpfen in Blitzeseile harmlose Faultiere fressen, während man nachts im Zelt liegt und die Affen jaulen. Hier ist nichts, hier lebt man nicht gerne, hier wäre man doch lieber wieder im Ruhigen und Bekannten anstatt im Ungewohnten und Spannenden. Und gleichzeitig kann man auch nicht heimkehren. Wenn wir jetzt wieder umkehrten, ich jetzt zurück nach München ginge, dann läge ich auch verkehrt in der Welt herum. Ich hätte wieder München und den Englischen Garten und die Gemütlichkeit dessen, was mir immer behagt hat, und doch wäre in mir immer die tiefe Scham, dass ich die Einsamkeit, das Unbekannte, das Wagnis des Alleinseins, das Risiko des Allein-Seinen-Weg-Findens nicht ausgehalten habe und stets bloß zurückwollte in das, was mir bekannt und am Ende ja wohl unerträglich geworden ist. Schließlich habe ich mich freiwillig einschiffen lassen, ich bin freiwillig hier, weil ich es in München auch nicht mehr ertragen habe. Würde ich jetzt aber zurückkehren, wäre ich wohl wieder in der Heimat und glücklich, ja, aber ich würde mich schämen, ich würde mich hassen. Weiter hier zu sein, heißt: Zivilisation von sich abschütteln, Umgangsformen ablegen, Beine abhacken und Blumen katalogisieren. Rückkehr heißt: Selbstachtung abschütteln, sich an das Fremdgewordene kuscheln, glücklich sein und trotzdem traurig. Lieber bin ich dann ein Bewohner der traurigen Tropen, so wie ihr, Wägele und Meinhold es seid. Lieber bin ich wild und fernab alles Menschseins als im Glück geborgen und ohne Achtung vor mir selbst. Wir müssen hier verharren, unfähig zur Aktion, zu nichts als Selbstmitleid fähig bei schwüler Sonne und fröhlichem Klang der Papageien. Dieses Selbstmitleid sei unsere Waffe! Diese Melancholie sei unser einziger, zorniger Widerstand gegen all das, was nicht mehr war, sondern nun nurmehr ist. Ruhe in Frieden, Ignaz Meyer."
Wohl schon gegen Anbruch des nächsten Morgens verabschiedeten sie sich von den Missionaren. Sie würden weiter den Fluss hinauf, es gäbe dort noch einiges zu entdecken, ihre Expeditionen seien noch lange nicht vorbei. Als Dank für ihre Hilfe überlässt Burckhardt den Missionaren die penibel geführte Kopie seines bis dato entstandenen Forschungsberichts. Diese Kopie ist das einzige Zeugnis der Expedition, das fortgeführte Original Burckhardts findet sich nicht mehr unter uns. Die Missionare gaben ihnen Trinkwasser mit und entließen sie mit Gottes Segen. Und wie dort die Kladde mit der Kopie des Forschungsberichts allein bei den Missionaren verblieb, so fühlte sie sich vielleicht ein wenig gramvoll, vermisste ihren erstgeborenen Zwilling, der weiter mit Burckhardt den Amazonen-Fluß entlangschippert, während sie so allein in der Fremde zurückblieb. Und so sah sie - gemeinsam mit den Missionaren - dem Floß zu, wie es sich immer weiter von ihnen im ewig über dem Wasserspiegel schwebenden Morgennebel entfernte, wie Burckhardt, Wörderhoff, Dornberg, Gussholdt und wie sie alle heißen immer kleinere schwarze Punkte am Firmament wurden, so winzig wie die Moskitos in der Nacht, so unbedeutend wie der Blutstropfen, der die Piranhas anlockt, und so schwarz wie das Wasser, das nachts in wunderbarer Klarheit das Bild der südlichen Gestirne spiegelt. Und irgendwann, da war das Floß wohl unwiederbringlich am golden schimmernden Horizont verschwunden, und mit ihm der Forschungsbericht, und mit ihm all die Entdecker, und ja, du ahnst längst, was aus ihnen wurde.

Mai 2018. | Danke sagen
6 notes
·
View notes
Text
Gründonnerstag
29. März 2018, Gründonnerstag.
Ein Abschweifungstagebuch.
Vielleicht einfach mal wieder mehr Tagebuch schreiben. Notfalls auch ein Wochenbuch, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Tagesrhythmus festhalte, ist eine winzige. Es gäbe auch nicht viel zu berichten in täglicher Lieferung, denn obwohl einem zweifelsfrei in jeder Sekunde derzeit berichtet wird, wie überlastet doch unser aller Informationsspeicher sei und wieviel gleichzeitig passiert, und man allenfalls noch wie ein durch die Atacama-Wüste gepeitschtes Maultier dem ewigen Werden und Vergehen der Informationen hinterher hecheln könnte, so ist es doch gleichsam richtig, dass das wirkliche, physische, im nicht zum Punkt zusammengeschmolzenen Raum und in der noch linear verlaufenen Zeit stattfindende Leben genauso ereignislos ist wie noch vor fünf Jahren. Der Rhythmus von Arbeit und Freizeit ist immer noch da, Langeweile und Kurzweil wechseln sich so unmerklich ab wie die Gezeiten in einem Fjord, dann und wann ziehen Gewitter vorbei und es fällt einem kurz wieder ein, dass es so etwas wie Wetter gibt. Den Rest der Zeit schläft man oder schaut aus dem Fenster.
Als Kind las ich in einem alten katholischen Lexikon aus den Siebzigern, das warum auch immer zuhause bei meinen Eltern im Schrank lag, und mich stets wegen all der unfreiwillig unheimlichen bis hin zu lustigen Renaissance-Gemälde in den Bann zog. (Es gab anscheinend in der Renaissance diese eine, mehrere Jahrzehnte lange Epoche, in der Perspektive und dreidimensionale Körpergestaltung noch recht lumpenhaft entwickelt war, und wir uns heute Gemälde von bspw. Andrea Mantegna eher als befremdliches Faszinosum denn als bewundernswertes Kunstzeugnis anschauen: die Spinnenfinger, die Kartoffelgesichter, die erwachsenen Gesichtszüge des Jesukindleins. Es gibt auch mehrere Tumblr-Blogs, die sich der verbiesterten Hässlichkeit ungeschickter Renaissance-Gemälde widmen. Etwas Ähnliches wird man aber in wenigen Jahrzehnten angesichts der Digitalisierung auch über unsere Gegenwart sagen. Auch unsere Gegenwart wird in nur wenigen Jahrzehnten als eine Gegenwart der verbiesterten Hässlichkeit und einer generell sehr großen Ungeschicktheit gesehen werden, deswegen sind wir gut daran beraten, uns in Demut zu üben, was ja auch was sehr Katholisches wäre, übrigens.) In diesem katholischen Lexikon jedenfalls war stets von „Stundenbüchern“ die Rede. Damals wusste ich noch nicht, dass Stundenbücher meist opulent illustrierte Verzeichnisse über all die verschiedenen Gebete im Tagesablauf waren. (Die Gebetszeiten waren in sogenannte Horen geteilt, durch die der Tag in mehrere Drei-Stunden-Blöcke aufgeteilt wurde. Das begann tief in der Nacht mit der sogenannten Matulin, dann ging es um 6 Uhr früh mit der Prim weiter, direkt danach quasi gab es die Laudes (in den Sechzigern ist einem die Redundanz aufgefallen und die Prim wurde ins Fegefeuer verbannt oder ins Vatikanische Geheimarchiv deponiert, auf jeden Fall gibt es sie nicht mehr) und so geht es dann weiter und weiter und weiter und irgendwann ist man wieder in der Nacht angelangt, vermutlich komplett erschöpft, und muss noch das Komplet beten, was am Ende mit der „marianischen Antiphonie“ endet, was anscheinend ein Call-and-Response-Gesang des alten Christentums ist, aber so sehr interessiert mich das jetzt nicht, als ich es recherchieren würde. „Marianische Antiphonie“ klingt wie ein seltenes Gehirnleiden.)
Auf jeden Fall schreibe ich all dies bloß, weil ich als Kind das Wort „Stundenbuch“ für eine Extrem-Version des Tagebuchs hielt. Die Leute im Mittelalter, dachte ich, hatten anscheinend außer Ritterturnieren und Beulenpest so wenig zu tun, dass sie sich stündlich an ihr Schreibpult stellen konnten und mit Gänsefeder und Tintenfass aufschreiben konnten, was sie so den lieben langen Tag taten, stündlich aktualisiert. Gewissermaßen ein karolingisches Twitter. Ich stellte mir so mythische Personen wie Hildegard von Bingen vor, die sich stündlich zum Schreibtisch begab, und beschrieb, wie sie mal wieder Alraunen gepflückt hatte, die wie kleine vom Teufel bewohnte Menschenfiguren in der Erde steckten, wie sie sie daraufhin sicherheitshalber 24 Stunden lang in Weihwasser eintauchte, und sie danach gegen sexuelle Begehrlichkeiten zur Heilanwendung empfahl. (Männliche Patienten erhielten die weiblichen Pflanzen zum Verzehr, weibliche Patienten die männlichen. Falls jemand von der Schwermut befallen war, empfahl sie stattdessen, die Alraune mit ins Bett zu nehmen wie eine menschengeformte Wärmflasche, und ein Gebet zu sprechen. War keine Alraune vorhanden, taten es zur Not auch einige Bucheckern. Frische Alraunen fand man immer unter Galgen und an Richtplätzen, schreibt von Bingen weiter, freilich noch unschuldig für die Schwachsinnigkeit der Annahme, denn Wissenschaft und Empirie zog im Mittelalter nur so unbeständig und selten an den Menschen vorbei wie im Frühling ein Gewitter, oder im Bach eine Forelle an den Füßen. Möge man die Alraune ernten, müsse man sich gegen den schlimmen Schrei wappnen, den sie dabei ausstoße. Eine Methode zur Ernte bestand darin, dass man die Pflanze zunächst dreimal mit dem Schwert umschreibt. Dann stellt man sich mit dem Gesicht nach Westen vor die Pflanze und beginnt zu graben. Während der Grabetätigkeit sollte ein Helfer im Kreise umhertanzen und von den Freuden der Liebe sprechen.)
All das schreibe ich, während vor meinem Fenster unaufhörlich der Wolkenbruch heruntergeht. Vielleicht schaffe ich es demnächst, ein Tagebuch mit weniger Abschweifungen zu schreiben, aber vielleicht sind es ja auch die Abschweifungen, an die man sich später erinnern wird. Dass ich den Tag lang im Theater saß, ist gar nicht mal so interessant. Im Laufe des morgigen Tages, gegen Mittag etwa, wird Jesus Christus nach mehreren Stunden der Marter am Kreuz sterben, denn morgen ist Karfreitag. Später gehe ich ins Fitnessstudio und heute Abend schaue ich mir was auf Netflix an.
2 notes
·
View notes
Text
Soon-To-Be Innocent Fun
Der Titel des Gedichts ist von Arthur Russell und Julius Eastman hat Musik geschrieben, die so klingt wie die Musik, die in meinem Kopf lief, als ich es schrieb.
“As a scientist, I find you very interesting.”
Man muss ein bisschen klettern, um ins Kinderzimmer zu kommen, über die Schachteln und die Tüten
und das alte Sofa vom Sommer 95, was da immer noch steht
(das ist aber echt peinlich, dass das da steht),
aber Mimi, das rosa Auto und den braunen Hund mit den roten Augen,
die finde ich ganz alleine,
und meine verschmierte Collage mit den Gesichtern der Autoren von WAS IST WAS,
und bring alles zu Mutter,
die immer noch ein bisschen weint, aber das Weinen ist nicht schlimm.
Mein Fahrrad hat Mutter aufgebaut, nach dem Frühstück die Matratzen weggepackt,
die Bettdecken auch, alles mit Handschuhen natürlich und sie wäscht alles sehr gewissenhaft.
Sie sagt, man dürfe mich nicht mehr berühren, sie habe Angst vor den ganzen Käfern,
die sie nachts im Bett kriechen hört.
Mutter riecht nach Zigaretten, Milch und durchdringender Schmierseife.
Wo sind nur deine Sachen, sagt sie.
Das ganze Scheißgeld war in deinen Sachen, heult sie.
Das darf doch jetzt nicht alles einfach so hier weg sein.
Dann rennt sie weg und sucht ihre Zigaretten.
Kommt zurück ohne Feuerzeug, geht wieder raus, nimmt sich ihr Feuerzeug, geht wieder rein und schaut auf den Kalender, geht wieder raus, nimmt sich ein anderes Feuerzeug (war wohl das erste leer), geht rein, raucht,
raucht,
sagt „das erste Feuerzeug war leer“,
raucht.
Ich geb dich nicht her, sagt Party Ville und ascht auf den fleckigen Boden und
streicht mir die abgefuckten Strähnen aus dem Haar,
von denen die Fotografen downtown meinten, sie gäben mir etwas Retrospektives.
Verklärtes.
„Grunge“, meinten sie.
„Matt Lambert.“
.Mir wird kalt, mir frieren die Lungen ab, kristallen fallen mir die erfrorenen Lungenflügel ab und prallen auf meinen knisternden Magen. Mein Vater ist fort, er ist im Krieg.
Für immer das Fenster offen.
Das ist wegen der Käfer, sagt sie.
Dann küsst sie mich auf meine Stirn, auf meine Augen und auf meinen Mund
Dann geht sie,
dann geht sie wie eine Diva,
geht sie den leichten Unebenheiten in der Tapete
mit ihren unheimlich langen und dünnen Fingern
ihrer rechten Hand nach. Spinnenfinger nennt man es, das ist eine Erbkrankheit.
Es klirrt, und vielleicht fällt was um. Die Statik in diesem Gebäude war noch nie sonderlich überzeugend. Es fallen immer mal wieder Dinge um.
Allein die ganzen Unebenheiten unter der Tapete, die sie mit ihren atavistischen Spinnenfingern abfährt, als wäre es Braille.
2 notes
·
View notes
Text
Hiberner Toujours
Dann und wann mag ich es sehr, Kommata da zu setzen, wo man sie nun wirklich nicht zwingend setzen müsste, beispielsweise nach dem "Haha" einer Whatsapp-Nachricht, denn "Haha, klingt gut" klingt eher wie ein tatsächlich gesprochener Satz als das atemlos-überstürzte "Haha klingt gut."
Ich lege mich auf die Hut und schaue auf den Parkplatz, der in grauer Stille den Sonntag über sich ergehen lässt, so wie ich, nur dass er dabei keine Musik über Kopfhörer hören kann, so wie ich. Die eine oder andere Schneeflocke senkt sich aus unvorstellbarer Höhe hinab, nur um auf den grauen Asphalt so schnell zu verschwinden wie die Stunden des Tages. Meine Observation ist sinnlos, es parkt kein Auto an diesem Sonntag, die ganze Welt ist unterwegs. Ich breche die Aktion ab. Mühsam gehe ich nach Hause, schweigend schritt ich weiter.
Wenn man einen Igel findet, lese ich in der Zeitung, der es nicht schafft, sich selbst im Winter zu versorgen, muss man ihm einen Laubhaufen kehren und durch ein kompliziertes Balz-Ritual verschiedenster Tänze und diverser Schenkungen von Nüssen, Gräsern und ein wenig morschem Holz dafür sorgen, dass er in diesen selbst gekehrten Laubhaufen einzieht. Den Einzug in den Laubhaufen nennt man im Fachjargon “Große Einkehr” und ist seit Jahrhunderten in den verschiedenen Kulturkreisen der Erde geläufig. Im Laubhaufen baut der Igel sich dann seine erste eigene Wohnung, hängt sich Poster an die Wände und wärmt sich im warmen, nur langsam zersetzenden Abfall der Bäume. Im Frühjahr zieht er in die weite Welt hinaus und fliegt mit den anderen Zugvögeln in den Süden.
Ich habe ein zu geringes Lungenvolumen, um wirklich gut singen zu können und in den letzten Momenten einer gesungenen Silbe versiegt mir meistens die Luft. Mittlerweile schneit es stark, in festen Böen gegen die Nordseite des Hauses.
Du schreibst mir in deiner letzten Nachricht: Lass uns schwimmen gehen, der Pastor an der Leine, das Kind in den Wolken, die Wilde Jagd in den Bäumen, ziehen wir uns die Badehosen an, oder wir ziehen keine an, der Wind an den Gleisen pfeift in die Dosen der Bettler und es ergibt sich unheimlicherweise eine Melodie, aber keine bekannte, zumindest aber ist sie ohrwurmtauglich und am Ende der Straße ist ein Kiosk mit kleinen Murmeln aus Zucker, ich trage dir eines in den Mund, du legst mir eines auf die Stirn, wir schlagen uns bis auf das Blut zurück in das Wasser, das unsere Körper umfängt wie eine umgekehrte Geburt oder eine Motte mit ihren so staubbedeckten Flügeln. Heute ist unser letzter Urlaubstag, heute fahren wir an das Meer, heute ziehen wir in den Krieg. Ich erinnere mich an deine Frage, ob Facial oder auf die kleinen Höcker der Wirbelsäule. Ich erinnere mich an die Hütte im Wald, ich erinnere mich an den Lampenschein und die leeren Pfandflaschen, an das Intro der Tex Avery Show im Nationaltheater von Oklahoma, ich erinnere mich an den Wahlspruch Quebecs ("Ich erinnere mich"). Ein Winterschlaf, ein Medium-Wasser, das Hinwegstreichen über Traurigkeiten, das Aufsaugen des Traubenzuckers aus deiner Hand im Schatten des Birnenbaums, und ich habe Angabe beim Federball.
Am letzten Urlaubstag trage ich stets schwarze Kleidung, fällt mir auf. Ich setze mir die Maske aus Federn auf den Kopf, um im Bett weiter im "Lob des Schattens" zu lesen, dort wo ich das Lesebändchen zuletzt habe ruhen lassen.
Für dieses Jahr melden die Wetterberichte Schnee allenfalls in höheren Lagen, keineswegs aber im Flachland. Ich kann nicht über jemanden schreiben, ohne dabei nonstop an wen anders denken zu müssen.
2 notes
·
View notes
Text
Notizen zum Totenreich / William Basinski
Das Fotoalbum auf unserem iPhone ist das präziseste Totenreich, das je erschaffen wurde - präziser als jede opulente Totengruft, als jede poetische Grabesrede - denn anders als die Künste muss ein Foto keinerlei Symbolik oder Abstraktion verwenden, sondern kann ablichten, was ist und wie es war. Wo das Gemälde noch so überzeugend allenfalls versichern kann, beglaubigt und verifiziert bereits das Foto. Und wenn das alte, in Kunstleder gebundene Fotobuch im Wohnzimmerschrank der Eltern, mit der weiß-milchigen Trennungsseite zwischen den einzelnen Fotografien, einen physischen Ort besitzt, aus dem uns die Erinnerungen, die Vergänglichkeiten, die Toten anlächeln und zuprosten, so ist die Fotogalerie auf dem iPhone oder auf Facebook, in der digitalen Wolke zugegen und all die vergangenen Zeiten residieren dort so körperlos im Nirgendwo wie unsere eigene Erinnerung selbst, zwischen den Welten, zwischen dem Hier und Dort. Jeder noch so harmlose Schnappschuss wird irgendwann zum Punctum werden können, dass uns trifft und sticht. "Oh, vergehendes Daguerrotyp in meinen langsamer vergehenden Händen", schreibt Rilke und Kracauer ergänzt, in der vollends abgelichteten Gegenwart denken wir zwar, wir hätten uns dem Tode entrissen, doch in Wahrheit haben wir uns ihm preisgegeben.
Was ich an der Musik des Komponisten William Basinski so schätze, ist, dass er Klang bereits stets als Zeugnis der Geschichte begreift. In seinem musikalischen Werk ist nichts clean, sondern stets bereits durch den Filter des Verschwindens beeinträchtigt. Seine Musik erreicht uns wie das Deja-Entendu eines Traumes, oder wie die nur nach emsigen Nachdenken rekonstruierbare Melodie einer Erinnerung (die Melodie des Schrottsammlers, damals auf dem Heimweg vom Schulbus), oder wie das allmähliche Aufsprießen der Farben in einer sich in der Dunkelkammer befindlichen Fotografie.
Basinskis Melodien verbergen sich hinter Störgeräuschen, hinter Artefakten längst schon obsoleter Medien (das Knistern der Vinylplatte, das Rauschen des bespielten Kassettenbandes, das kurze Ausfallen des Tons durch Übersteuerung zu laut abgespielter Töne, etc.) und erreichen so eine maximale emotionale Durchlässigkeit - sie verraten dadurch ihre eigene Geschichte, ihre Herkunft, ihren Entstehungsprozess und werden dadurch klar in einen Kontext eingearbeitet.
youtube
Das Werk, das mich derzeit am meisten begleitet - das schlicht 92982.2 genannte Werk - lässt einen alten, orchestralen, vor lauter Wehmut beinahe platzenden Kassettenloop vor dem Rumoren einer Großstadt erklingen. Jederzeit offenbart sich anhand der Aufnahme, wie alt sie ist: Die Zeichen der Zeit sind ihr eingeschrieben. Die Großstadt wirkt nah und fern zugleich, als würde man sich mehrere Dutzend Meter über ihr befinden, vielleicht auf einem nahegelegenen Hügel, vielleicht auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung. Ich muss direkt an meine sehr große Terrasse denken, die ich bei meiner Dachgeschosswohnung in Athen hatte. Als ich - wie so oft - nachts in Pyjama und Boxershorts in der Dunkelheit auf dem Liegestuhl saß, in die stets vom orangenen Glimmer der Straßenlampen verfärbten Nachtwolken sah und danach meine Augen schloss, um schläfrig zu werden, klang die Stadt tief unter meinen Füßen exakt so: auf- und abschwellende Sirenen, die zum puren Nebel wurden; ein leiser Donner der häufigen Sommergewitter weitab in der Ferne der Gebirge; ein Ruf, ein Knall, undefinierbarer Sound aus allen Himmelsrichtungen.
Vladimir Nabokov schreibt direkt auf seiner ersten Seite der Autobiografie mit dem schönen Titel Erinnerung, sprich von einem Freund, der Chronophobiker sei und somit Angst vor der Zeit bzw. ihrem Vergehen habe. Als der Chronophobiker einmal ein Foto seiner Familie sah, das nur kurz vor seiner Geburt entstanden sein musste - ein Schnappschuss, keine besonders geglückte Aufnahme zumal - bekam er es mit dieser Angst zu tun: Hier, schwarz auf weiß, war Zeugnis seiner Abwesenheit. Die Geschwister und Eltern des Chronophobikers, sie alle sahen gleich aus. Sie bewohnten das gleiche Haus, die Pflanzen im Garten sahen gleich aus, alle schienen zufrieden. Niemand schien ihn zu vermissen. (Wie auch, er existierte ja auch noch gar nicht.) Diese Erkenntnis jagte dem Chronophobiker jedoch eine wahrhaftige Krise ein. Ähnlich wie nach dem Tod sind wir auch vor unserer Geburt nicht vorhanden, es entsteht eine Lücke, die wir niemals füllen werden können. (Anders als nach unserem Tod hat uns vor unserer Geburt nicht mal jemand jemals ansatzweise vermisst.) Das Medium, das uns diese unverschließbare Lücke vor Augen führt (das verschwommene Foto eines Toten, das grobkörnige Homevideo unserer Familie kurz vor unserer Geburt, generell Aufzeichnungen, die über Zeit und Sediment verfügen), wird uns direkt unheimlich oder berührt uns auf seltsame Art und Weise.
Man beginnt über Zeit nachzudenken, über Natur und Geschichte, über Verwandlungen und Transformationen. Die große Länge des Stücks 92982.2 - knapp 23 Minuten, in denen dramaturgisch jedoch äußerst wenig passiert - trägt dazu bei, aus dem Hören ein echtes Ereignis zu machen. Seltsamerweise gibt es fast kaum andere Musiker, die das abstrakte Konzept der Vergänglichkeit anschaulicher und leibhaftiger darstellen, als diese manchmal tatsächlich vor unseren Ohren vergehende, manchmal bloß wie ein Memento Mori oder Vergangenheitsrelikt vor uns auftauchende Musik. All die Sounds, die in dem Werk auftauchen - das Telefonklingeln, Baustellenlärm (?), eine Krankenwagensirene - sind typische Codes einer emsigen Großstadt, erhalten jedoch auch etwas Elegisches. Als wären sie archivierte Aufnahmen einer Edison-Walze, die wir nun mit großer Scheu, Ehrfurcht und der oben beschriebenen ontologischen Furcht hören. Sie sind Zeugnis.
Zeugnis wofür? William Basinski nahm den Track - wie auch das gesamte Album 92982, dessen Titel nichts anderes ist als die amerikanische Schreibweise des exakten Datums - am 29. September 1982 auf, und zwar tatsächlich - und das lese ich erst im Nachhinein - mit weit geöffneten Fenstern mitten in der Nacht, in seinem Dachappartment in Brooklyn, New York, das er mit seinem Partner James Elaine, einem bildenden Künstler, der ebenfalls das Thema der Vergänglichkeit brillant zu illustrieren vermag, bewohnt. Wir hören einen Track, der bereits vor 35 Jahren aufgenommen wurde, doch erst vor wenigen Jahren veröffentlicht wurde, damit die Zeit über diese Jahre hinwegstreichen kann und sich in unseren Köpfen Assoziationen anhäufen können. Wir hören das alte, untergegangene New York, das “Old New York”. 1982, all die Nachtclubs, all die Künstler, die No Wave-Szene, die Disco-Szene, die Schwulenszene - all diese Szenen, die in den folgenden wenigen Jahren einer rigiden Stadtplanungspolitik zum Opfer fielen und dessen Protagonisten tausendfach, zehntausendfach, an einer, 1982 noch weithin unbekannten, Immunschwäche erkrankten, die sie innerhalb nur weniger Monate und Jahre in der Mitte ihres Lebens zu kaum mehr wiedererkennbaren Gerippen werden lässt, bis auch sie vergehen wie eine weitere der zahllosen Sirenen in der Nacht.
(L gewidmet)
2 notes
·
View notes
Text
Pflichten
Textkorpus eines kurzlebigen Twitter-Bots, den ich eine Zeit lang betrieben habe.
Errichte ein kleines Haus inmitten von Ruinen. Ertrinke jenseits des Sichtfeldes. Vergess die Erzählung von dir, die du bei Facebook transportieren willst. Springe auf den Lücken Trampolin. Lass das Zischen der Abgasleitungen dein Beat sein. Sei ein pures Weiß ohne Form oder Konsistenz. Gieße den Kadaver mit Honig und Hyazinthen ein. Sammle in einem Bruchmoor Pinienkerne, Fichtenholz und Silbertannenwüchslinge. Tanze die Apathie in deine Existenz hinein. Ebne deine Falten, bleiche deine Zähne, lösche deine Falten. Höre zu, wie sich die Eingeborenen wenige Illusionen machten. Schaufle im Wald, bis du Wurzeln triffst. Behandle Partner tagein, tagaus wie ein staubiges altes Kissen. Geleite die Toten. Schleife auf der Erde, während dein Kopf den Himmel durchtrennt. Lausche dem sich über viele Kilometer hinwegsetzenden Hallen der Zugbremsen in der Nacht. Stell dir gigantische, menschenleere Strände vor und trage ihr Quarz ab. Sei samt und sanft im aufgedunsen-trüben Fahrwasser. Schaue dem Fluss zu, wie er dampft. Verringere deinen Spielraum kontiniuerlich. Sei nie wieder ein Athlet und stelle dich nie wieder einer Herausforderung. Zieh die Vorhänge zu, bevor uns jemand sieht. Glaube nicht, dass die Leere existiert, die jenseits der Schatten auf uns alle wartet. Konstruiere Deklinationen für Siedlungsnamen. Führe dich der rituellen Vereinsamung zu und tanze mit den toten Leibern Boogie Woogie. Entkomme der Kluft. Lege deine schwitzige, keusche Hand neben meine auf das Uferholz der Strandpromenade. Schau den Staubkörnern zu, die im Septemberlicht durch meine Blicke schweben. Schabe sanft an der Baumrinde und fühle ihr schlechtes Gewissen.. Erstelle Archive über Jahreszeiten, Inseln, Museen und Eintrittskarten. Erlebe den kranken Herbst und den kränkelnden Sommer in Echtzeit. Finde unsere enthaupteten Überreste am Grunde eines opalblauen Bergsees oder eines Brunnens. Sei der letzte schwebende Tropfen der Lavalampe vor ihrer Erkaltung. Geh nach Syrien. Töte die Natur und töte den Anführer. Lass deinen Leib korrupt werden und lass ihn seufzen. Rauche Asche, saufe die Glut. Gleite immer tiefer und immer zärter in den Korpus hinein. Setze deine Wurzeln in der Erdkruste fest. Gehe vor Anker im Zwischenreich. Schau durch dein Teleskop und entdecke Knochen, Ketten, primitive Musikinstrumente und Abdrücke barer Füße auf der Mondoberfläche. Verstecke dich im digitalen Signal. Spüle dich in der Welle der Instagram-Bilder fort. Fürchte dich vor Dunkelheit, Spiegeln, vor fahlen Lippen, Eulen und der Gier. Reiße dir die Oberschenkel auf, schöpfe ihr Gold und male Gemälde. Erstelle Broschüren und bringe sie in Umlauf. Atme. Entwickle einen Umhang für wirbellose Tiere und einen Fetisch für Insekten und sakrale Gebäude. Reise der Schlange hinterher, wo auch immer sie sich anstellt. Finde deinen Körper auf anderen Körpern wieder. Entledige dich hexagonaler Behälter, dendritischer Kristalle und Diamantenstaub so rasch es geht. Zersetze endlich deinen kreativen Drang. Lasse in den Werken der Dichter nur die Kommata stehen und verbrenne den Rest sorgsam. Zelte in der kosmischen Matrix und trage deine Haare kurz. Singe und schieße mit deinem Schießgewehr. Sei ein Wesen, das wegen seiner selbst existiert. Werde mit nichts assoziiert. Kontexualisiere die pecherne Schwärze. Konsumiere Drogen und spüre die Käfer unter deiner Haut. Kombiniere deine sexuelle Attraktivität mit deinen Angstgefühlen. Kärchere Mandalas in die vom Tabak geschwärzten Steine am Nordausgang des Hauptbahnhofs.
2 notes
·
View notes
Text
Monolog eines Matrosen
Der Matrose geht zur Bugseite des Boots und sagt in die ihn aufzeichnende Kamera: Wir lagen vor Andalusien, südlich war nur noch Afrika. Joseph, unser Kapitän, hatte vorhin zum fünften Mal in Folge eine Partie Rummikub verloren. Wir spielten immer Rummikub, wenn Flaute war und die Segel sich nicht regen wollten. Schon neun Stunden lang Flaute, kein Lüftchen mehr. Das ist vor Andalusien, sagte man uns, bevor wir auf das Schiff gestiegen waren, relativ normal. Wir freuten uns auch ein wenig über diese Flaute, denn die vorherigen Tage waren rasch vergangen, stets wehte eine steife Brise, die Segel blähten sich im Wind auf und ab wie die Wangen eines Frosches zur Paarungszeit. Sie leckten an den Masten wie in einem vulgären Spiel. Wir alle hatten seit Wochen keinen Geschlechtsverkehr mehr gehabt. Wir waren damals von solchen Metaphern aus dem großen, bunten, dem geheimnisvoll schönen Reich der Anzüglichkeiten wie besessen. Wenn es Bananen gab – gegen das Skorbut, die Syphilis und gegen Grippe – mussten wir uns vor Lachen die Bäuche halten. Sie verstehen das schon. Naja, also hatten wir vor dieser Flaute vor Andalusien keinerlei Probleme mit dem Wind. Die Gischt spritzte uns ins Gesicht und wir lachten verständlicherweise darüber, aber etwas verschämter. Der Wind spielte sein Spiel mit und peitschte uns über den Atlantik. Wir hatten überhaupt keine Zeit für Rummikub und ehrlich gesagt litt die Laune ein bisschen darunter, denn auch die zwanzigste Metapher aus dem sexuellen Bereich wird irgendwann fad. Wir fühlten uns ein bisschen unterfordert, beinahe hätten wir Therapie nötig gehabt. Wir dachten uns, ach, wenn doch nur irgendwann einmal Land in Sicht kommen würde und wir endlich mal am Hafen in den Tavernen und Spelunken ein bisschen Rummikub spielen könnten. Meine schon ganz zerknitterte und verfleckte „Querelle“-Ausgabe hatte uns alle auf das akkurate Verhalten in einer Hafenkneipe vorbereitet. Wir waren gewissermaßen gerüstet. Wir wollten uns Rum hinter die Binde gießen, Gin in den Schädel kippen, Rummikub spielen, bis die gute liebe Morgensonne uns die Nacht aus den Köpfen scheint.
Unser Kapitän Joseph erzählte uns abends, als wir die wässrige Suppe mit den Rindfleischstücken aus dem großen, verbeulten Schnellkochtopf schöpften und auf unsere gelben Plastikteller gossen, wie er 2004 im Rahmen der großen deutschen Spiele-Messe „Spiel“ in Essen der Weltmeisterschaft im Rummikub beigewohnt habe und dass ihn dieses Erlebnis gebrandmarkt hatte, dass es gar jenes Ereignis gewesen sei, dass ihm die Epiphanie gebracht habe, Hochseekapitän zu werden und mit uns mutigen Jungs über den Ozean zu segeln. Er sagte uns, dass er anfangs am Rande des Spielfelds stand und ihm dabei ein warmes nostalgisches Gefühl die Venen durchfloss. All dies geschah nur wenige Minuten, bevor die Kontrahenten der Rummikub-WM sich an die eichenholzschweren Spieltische zu setzen begaben, und er sagte uns, wie er missmutig stöhnte, welch absurdes Spiel Rummikub doch sei und wie bizarr allein die Vorstellung schon wäre, dass sich erwachsene, sicherlich nicht dumme oder seltsame Menschen in heiligem Ernst um dieses Spielfeld setzen würden, um allen Ernstes um den Weltmeister-Titel zu spielen, ohne einzusehen, dass es doch purer Wahnsinn wäre, so etwas so übertrieben ernst zu nehmen. Wir nickten wie die Wackeldackel, die einige Jahre lang für Kofferraumabdeckungen in Mode waren. Später am Abend, wir feierten gerade die Vesper, ging wieder ein wenig Wind. Wir trieben sanft gen Europa und die Segel blähten sich auf wie Schwellkörper im Penis, worüber wir herzlich lachten, bis die Sterne über unseren Häuptern ihr ewig leises Lied sangen.
0 notes
Text
Brief an bento
Hey Ole Reissmann,
das hier ist, glaube ich, der erste offene Brief, den ich so schreibe. Also bitte ich vorab um Verzeihung, dass ich dich damit so belange und falls er nicht so gelungen sein sollte.
Außerdem bitte ich um Verzeihung, da in diesem Text weder irgendwelche GIFs oder Emojis oder Selfies oder dergleichen auftauchen. Ich weiß, euer Bento-Verständnis von guten, zeitgemäßen Texten ist: Hauptsatz, Hauptsatz, Hauptsatz, drei Fotos und am Textende eine Zusammenfassung für alle, die wenig Zeit haben. Und das ist ja auch euer gutes Recht. Jeder darf und soll sein eigenes Verständnis von Texten haben. Ich hab gehört, die beim Print-Spiegel drucken sogar manchmal Texte, die länger sind als eine Seite. In kleiner Schrift und ohne Bilder! Haha, diese alten Hippies, was?
Ich hab auch sogar Verständnis dafür, dass ihr unseren Satireaccount @bento_is_hip (natürlich wiederum ein Imitat des lustigen, und übrigens auch noch nach Monaten friedlich existierenden Parodieaccounts @vice_is_hip) gelöscht habt. Ne, wirklich, Frauke und Ole und Maik und Stefanie und Frederic und wie ihr sonst noch alle heißen mögt! Kurzschlussreaktion! Kann mal passieren, mea culpa, mea culpa.
Da sitzt ihr im vom SPIEGEL-Papa mit geilen Laptops, hübschen Sitzecken, guten Kaffeemaschinen und flippigen Flipcharts ausgerüsteten, lichtdurchfluteten Großraumbüro und habt jetzt vom Papa die Aufgabe bekommen, irgendwie Journalismus für junge Leute ins digitale Zeitalter zu schleifen. Das soll gleichzeitig lässig und lustig, aber halt gleichzeitig auch total aktuell und betroffen und klug sein. Da soll der Spagat geschafft werden, zwischen dem traurigen Emoji mit der Träne und dem lachenden Emoji mit zwei Tränen. Ihr hofft auf Reichweite, auf Klicks, auf ordentlich – so nennt man das in eurer Branche – Buzz. Und worauf ihr vermutlich auch hofft: auf Anerkennung.
Anerkennung. Dass irgendwer euren Scheißjob anerkennt. Dass ihr nicht nur lausige GIF-Sammler, Trendhinterherhechler, Popkulturnacherzähler, Hashtag-Replikatoren seid. Dass eure Artikel mehr sind als paraphrasierte Pressemitteilungen für US-Serien, die wir gefälligst alle „feiern“ (Bento-Sprache, ca. „sehr mögen“) sollen. Dass eure Politmeldungen mehr sind als ein Link, ein paar Erklärsätze und dann noch irgendwas zum Fühlen. Dass euch irgendwas unterscheidet von Buzzfeed, Himate, Ze.tt - dass man die Unterschiede sehen und lesen kann, und zwar nicht nur, wenn man eure Seiten mit einer Kneifzange anpackt und so lange dreht und wendet, bis einem irgendwas halt schon auffällt. Dass Menschen merken, wenn ihr abends den Laptop im Büro ausschaltet und für einen kurzen Moment denkt, hey, wir haben da wirklich gerade was gutes abgeliefert.
Und dann kommt einem so ein beschissener Satireaccount ins Gehege. Oah, wie nervig das halt sein muss. Die machen sich lustig – über euer Konzept! Über eure harte Arbeit. Über euren Versuch, wirklich was Großes, was Neues aufzubauen, vielleicht nicht gerade was inhaltlich Wertvolles aufzubauen, aber zumindest was mit guten Klickzahlen und okayen eingebetteten Anzeigen. Das Wort „Feuilleton“ müsst ihr googlen, aber sonst geht es ja eigentlich ganz okay.
Irgendwie muss dieser Account weg. Was wird Papa sagen. Das Konto hat noch nicht viele Follower, das fällt keinem auf. Vielleicht findet sich ja irgendein Tweet, der uns persönlich beleidigt? Hm, ne. Der irgendwie zu Spam verleitet? Ach, mist, auch nicht. Gewaltdarstellungen? Nope. Aber hier, dieser eine Tweet mit den Flüchtlingsheimen – das ist doch ziemlich scheiße, sogar rassistisch. Oder Ole, was sagst du dazu? Naja, Frauke, wenn du meinst, wird schon stimmen! Also schnell bei Twitter in Berlin angerufen, „Halli hallo hallöchen, wir sind die Jungs und Mädels von Bento, und zwar Bento vom SPIEGEL!“ in den Hörer geflirtet und die Sache hat sich. Der Account ist weg.
Wenn Leute darüber meckern – und das Satirekonto hat mittlerweile mehr als 900 Follower, über Nacht, ups – dann reden wir uns damit raus, dass der Tweet halt irre rassistisch war. Und später auch wieder gelöscht wurde. Das kann uns dann halt wirklich keiner nachweisen, was, Ole? Alles klar, Frauke! Die Leute werden sich mit uns solidarisieren, werden ihre Vorurteile ablegen, werden jauchzend und glücklich uns zur Info-Startseite machen oder uns zumindest auf dem Home-Screen speichern.
Leider ist es nicht ganz so gekommen, Ole Reissmann, und ihr habt euch mit der Satire-Aktion ziemlich ins Bein geschossen. Irgendwann kam dann raus, dass wir auf unserer Seite nie „rassistischen Scheiß“ gepostet oder diesen danach gelöscht hätten. Später reichtet ihr ein etwas durchdachteren Text nach: Ein Tweet von uns habe euch nicht gefallen. Ebenjener („Flüchtlingsheime anzünden: Wir haben den neuen Ekel-Trend ausprobiert“) würde eventuell dazu führen, dass ihr mit Ausländerhass in Verbindung gebracht werdet. Okay, anscheinend haltet ihr von der Medienkompetenz eurer Leser nichts. Zwischen Satire und dem Original könne man anscheinend nicht mehr gut genug unterscheiden. Was für ein Triumph für uns, wenn ihr zugeben müsst, dass wir zu nah am Original waren, anscheinend.
Es sei eine Kurzschlussreaktion gewesen. Im Nachhinein sicher auch ein Fehler. Mea culpa. Mea culpa. Wir waren ganz schön unsouverän und dämlich, oder, Frauke? Ja, und auch echt uncool, Ole!
Anfangs war ich ziemlich wütend darauf, dass ihr einen für euch eigentlich völlig ungefährlichen Satire-Account abschießt, sobald er am Horizont auftaucht. Dass ihr wirklich gedacht habt, dass euer oberflächliches Journalismus-Imitat so gut und korrekt und zeitig ist, dass Satire es nun wirklich nicht braucht. Dass ihr auch ganz gern mal lacht, abends oder so, in der Kneipe, hinter vorgehaltener Hand, aber manchmal hat der Spaß auch Grenzen! Dass ihr gegen Satire mit den gleichen Zensur-Maßnahmen vorgeht wie gegen echte Nazis, echte Rassisten, die es auf Twitter zuhauf gibt und gegen die dann aber meistens ein Scheiß unternommen wird! Dass ihr nicht rafft, dass euer Selfie-Journalismus keinen Platz mehr lässt für Theorie, Analyse, Kritik und Einordnung. Dass Leute, die dies dann als Satire auf die Spitze treiben, sofort von euch vertrieben werden müssen.
Keine Angst, ich krame jetzt nicht die viel zu oft zitierte Halbwahrheit „Satire darf alles!“ raus. Darf sie nämlich nicht. Unser Tweet „Flüchtlingsheime anzünden: Wir haben den neuen Ekel-Trend ausprobiert!“ war wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Er sollte aber zeigen, dass euer Selfie-Journalismus für das Selfie alles tun würde. Für den Klick, die Reichweite, den Buzz. War der Tweet übertrieben? Natürlich! War er ungerecht? Na aber hallo! Wäre es ein TITANIC-Cover, würdet ihr es happy in „Lustige Bilder vom Tage“ verlinken. Und doch war es nur einer von dreißig Tweets. Ihr habt den Diskurs verengt und wolltet von euch ablenken, auf uns böse böse Internet-Rambos. Ihr habt euch in eurer Spießigkeit und Verbiestertheit offenbart. Auf euch hagelte es mehr Spott als es unser kleiner, alberner Twitter-Account je gekonnt hätte. Twitterer schrieben, Blogs schrieben, Medien schrieben, Jan Böhmermann schrieb. So, there. Suits you well.
Warum ich aber immer noch angepisst bin, Ole Reissmann? Von dir, von euch? Nein, nicht wegen eurer Seite. Die ist mir ab sofort super-egal. Ich strafe euch mit kompletter Ignoranz. Sondern weil du Scheiße über mich verbreitest. Als Kommentatoren auf Twitter bemerkten, dass Satire ganz gern mal böse wäre und nach euren Maßstäben „Der Postillon“ schon längst gelöscht wäre, schreibst du: „Aber: Der "Postillon" nutzt nicht Namen und Logo einer anderen Marke und verbreitet so Flüchtlingsheim-Abbrennen-Sprüche.“ Du schreibst über uns (und damit vor allem leider über mich), dass ich Sprüche a la „Flüchtlingsheime abbrennen“ verbreite. Sag mal, weißt du, was für eine ungeheurliche Nazischeiße du mir damit unterstellst? Ich bin 22. Mein Name wird noch so einige Male gegoogelt werden, vermutlich auch beruflich. Ich möchte mit sowas nicht in Verbindung gebracht werden, nur weil du für dein hübsches Prestigeprojekt keinen Bock auf Satire hattest und dir die ganze Aktion im Nachhinein scheißepeinlich ist. Und weil du nicht die Eier hattest (Bento-Sprache, vgl.“ Mut“), mit uns in Kontakt zu treten. Was jederzeit möglich gewesen wäre. Wir hätten natürlich auch sofort beanstandete Tweets gelöscht. Uns ging es nicht um Bösartigkeit. Unser Ding war Parodie. Du denunzierst.
Du trittst nach und sagst, ich hätte Rassismus, Nazi-Parolen verbreitet. Wie weit möchtet ihr euch noch aus dem Fenster lehnen? Jetzt mal ernsthaft? Ist das euer tolles journalistisches Ethos? Falls ja, dann braucht Bento eh keinen Satireaccount mehr. Dann ist es eh zu spät.
Wenn ihr das nächste Mal also die zehn Tipps für das perfekte Selfie aufschreibt, dann guckt doch mal etwas länger in den Spiegel (Tipp Nr. 7, gibt’s an jedem Kiosk!) und fragt euch, ob euch gefällt, was ihr da seht.
Mit gar nicht mal so herzlichen Grüßen,
Matthias
34 notes
·
View notes
Text
Ulla Kock am Brink erzählt einem Millionenpublikum vom Tod
Unvollendete Erzählung, 2014. Inspiration von Wolfram Lotz. Sollte Teil eines längeren Zyklus werden, in denen Fernsehpersönlichkeiten der Neunziger Epiphanien erleben (nein, tatsächlich wahr).
Ulla Kock am Brink, die Moderatorin der RTL-Spielshow Die 100.000 Mark Show, die schon den ganzen Tag unter buchstäblich grausig quälenden Rückenschmerzen litt, kurz vor der Aufzeichnung ihrer mittlerweile schon 85. Sendung einen ihre eh schon schlechte Laune nur noch verschlimmernden Anruf erhalten hatte und nun gewillt war, dennoch das Beste aus den zwei Stunden Aufzeichnung, die nun vor ihr lagen, zu machen, sah den Schwenk der Studiokamera 3 auf sich, sah das kleine rote Lämpchen neben der Linse, fasste beherzt und mit einer einladend wirkenden Geste an ihre Moderationskärtchen vor ihrer Hüfte und erzählte einem Millionenpublikum vor den Bildschirmen, den gut 250 Zuschauern im Studio, den sechs erschöpften und äußerst aufgeregten Kandidaten, den etwa 40 Technikern, Kameraleuten, Produzenten, Licht- und Tontechnikern im Saal sowie der Regie vom Tod. „Wissen Sie, meine Damen und Herren und liebe Zuschauer im Saal“, sagte sie, „wir haben uns den Tod immer ganz falsch vorgestellt. Wir stellten ihn uns stets als Dieb vor, als Räuber des Lebens. Wir stellten ihn uns irgendwie immer in schwarzer Kleidung vor. Als wir mit tränenerstickter Stimme am Totenbett des Liebsten saßen, mit tauben Fingern nach der Beerdigung den Erdbeerkuchen essen mussten, und als wir beim Sturm auf der Autobahn gefährlich nahe an die Leitplanke gerieten, da fiel er uns ein wie eine verschütt geglaubte Urlaubserinnerung aus der Kindheit. Liebes Publikum, wir glaubten, dass der Tod uns etwas wegnehme, dass er zwar seinen eigenen Gesetzen folge, man diese nicht anzweifeln könne, dass er ein großer Gerechter ist, aber dass man seine Entscheidungen durchaus beweinen kann. Meine Damen und Herren, liebes Publikum im Studio, wir hielten den Tod immer für einen Kontrahenten, einen sich äußerst fair verhaltenden Widerpart, der zwar immer gewann, aber auch immer kollegial und nachvollziehbar in unserem großen Spiel um die Herzen und die Köpfe die Regeln befolgte. Er war ein Guter, aber auch ein Schlächter. Schlächter mit einem ä geschrieben.“
Die Kandidaten schauen sich ratlos an.
„Der Tod hat jedoch uns heute und hier etwas anderes zu sagen. Der Tod ist gewissermaßen heute unser Studiogast. Und das, obwohl, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum im Studio, diese Sendung ja normalerweise ohne Studiogäste auskommt.“ Kurzes Lachen. „Doch der Tod, liebes Publikum, der Tod ist ständiger Studiogast. Der Tod wird von unserer Redaktion nie eingeladen, und doch ist er stets mit von der Partie. Er sitzt hinter den Kulissen auf den Klappstühlen, sitzt in den Zuschauerreihen vor und hinter Ihnen, neben und in Ihnen, zwischen Ihnen und Ihrem Begleiter. Er sitzt in der Regie, er sitzt über den Scheinwerfern, er liegt draußen im welken Gras vor den Studios, er sitzt natürlich auch bei Ihnen zu Hause vor den Bildschirmen.“ Die Regie lässt das vereinbarte Zeichen für Aufzeichnungsabbruch fahren, den Wechsel der Lichtstimmung von „Das Pentagon-Spiel“ in normale Arbeitsbeleuchtung. Alle Kameras, abgesehen von Studiokamera 3, werden abgeschaltet. Studiokamera 3 filmt, von den geänderten Lichtverhältnissen unbeeindruckt, stur weiter. Die Gründe dafür: a.) die Kamerafrau Stefanie R. fühlt sich zum Monolog der Moderatorin hingezogen, sie erkennt plötzlich eine große Ähnlichkeit zwischen den Gedanken der U.K.A.B., wie man die Moderatorin manchmal scherzhaft abkürzte, und ihren eigenen philosophisch-mürrischen Gedanken, die sie manchmal in sternklarer und schlafloser Nacht befielen wie ausgehungerte Piranhas eine blutende Kuh im Fluss; Stefanie R. sieht auf einmal eine große Seelenverwandtschaft zwischen sich und der Moderatorin, die im Laufe ihrer Karriere bereits zweimal ein Fotoserien-Angebot des Playboys abgelehnt hatte; R. erkennt ihr eigenes Scheitern an, das Scheitern des Lebens, die auf kurz oder lang immer den längeren Atem behaltende Kraft des Todes; b.) der Kopfhörer der Kamerafrau, der sie mit der Bildregie verbindet, ging in just jenem Moment defekt, in dem die UKAB ihren weiterhin ins Mikro dränenden, sich ins Mikro hinein salbadernden Monolog begann.
Die Kandidaten haben sich, immer noch ratlos umher guckend, auf die Studiokulisse gesetzt und tupfen sich den Schweiß von ihren Stirnen. Das Publikum ist ungewöhnlich ruhig, ja, quasi schon sanft.
Ein Regieassistent schaut mit einer Mimik, die höchste Verwirrung und eiskalte, simple, einfache Panik zeigt, in den grobkörnigen Vorschaumonitor der Studiokamera 3 vor ihm und flüstert leise, von allen anderen ungehört, zu sich selbst: „Was macht sie da?“ Und der Regisseur stapft durch den Regieraum und brüllt, was sie dort tue, sei gerade Karriere-Selbstmord, das sei Ausbruch einer Psychose, Ausbruch einer lange verborgenen klinischen Depression; er habe doch gewusst, dass die UKAB irgendwas habe, dass sie sich in den letzten Tagen und schon bei den letzten Aufzeichnungen so erratisch (er sagt: „seltsam“) verhalten habe; das dort, liebe Leute, ruft der Regisseur, das, was ihr da sehen könnt, das ist der Ausbruch einer Psychose oder einer… einer… nun, keine Ahnung, irgendwas, was mit der Silbe Psycho- beginnt. Er gibt seinem Assistenten mit der linken Hand fahrig ein Zeichen, die Sprechanlage zu bedienen und so sagt der Assistent mit brüchiger Stimme, aber vollkommen resolut zu den Kulissentechnikern und den zwei überforderten Sicherheitsbeauftragten am Rande des Spielfelds: „Holt sie dort raus!“
Dramaturgisch gesehen fiel Kock am Brinks Rede über, zum und an den Tod an einen der, aufgrund der mit heißer Nadel gestrickten Emotionsachterbahn von Dramaturgie, häufigen Knackpunkte. Man hatte gerade das ausgeschiedene, dritte Paar zum „Pentagon“-Spiel leiten wollen, wo sie noch um einen Trostbeitrag spielen konnten. Sie mussten dazu Gewichte aus einer fünfeckigen Metallkonstruktion ziehen, in jedem Gewicht war ein Umschlag mit Geld. Das Paar hatte bisher lediglich 1.200 DM erspielt, ein geradezu lächerlich niedriger Beitrag, das sind ja gerademal 600 Euro, sowas ist in einer Samstagabendshow undenkbar. Kock am Brink hatte von der tollen Leistung des ausgeschiedenen Paars erzählt, dass es ganz großes Pech gewesen sei, dass dennoch nur 1.200 DM zusammen gekommen wären, und dass nun alle hier im Studio und zuhause vor den Bildschirmen hoffen würden, auf dem Pentagon würden noch ein paar sich lohnende Gewichte von den mittlerweile völlig ausgelaugten Armen der Kandidaten emporgezogen. Ihr letzter Satz vor dem Zwiegespräch mit dem Tod (tatsächlich war Ulla Kock am Brink inzwischen in ein hymnisches „O Tod, was bist du uns heutzutage denn noch außer ein traurig durch die Gegend flatterndes Wort, ein leerer Begriff, eine Maske ohne Text, ein mit Theorien und Möglichkeiten, mit Philosophie und Gerede vollgestopfter Papierkorb, ein Ende vom Ende, ein blind gewordener Spiegel, in dem die Flamme des Düsteren lüstern flackert? O Tod, sag uns, was kannst du uns heute noch schaden, wo wir uns immer schneller durch den Weltraum bewegen, wo unsere immer rapider werdende Lebensgeschwindigkeit mit der Verfallsgeschwindigkeit nicht mehr wichtiger Normen und Werte, Konstanten und Endungen korreliert? O Tod, sprich mit uns, kläre uns auf, nicht erst im allerletzten Moment dieses Lebens“ et cetera verfallen) lautete: „Wollen wir doch mal alle hoffen, dass Karin und Markus das Gewicht mit den 10.000 DM erwischen!“
Karin und Markus saßen mittlerweile backstage und eine mit der Situation überforderte Aufnahmeleiterin erklärte ihnen, dass die Aufzeichnung abgebrochen wurde. Das Publikum im Saal bleibt ruhig sitzen und hört der UKAB weiterhin zu. Manche halten sich mittlerweile an den Händen, einige summen.
„Ich glaube, Tod, wir haben dich stets als Räuber wahrgenommen, weil wir dachten, das Leben sei das Einzigartige. Der Tod stiehlt aber nicht das Leben, sondern das Leben stiehlt den Tod. Vor uns und nach uns existiert nur Tod. Kein Leben. Vor unserer Zeugung sind wir tot und nach unserem Sterben sind wir tot. Tot, tot, tot.“ Ulla Kock am Brink hält dabei die Fäuste geballt, die Moderationskärtchen in die linke Faust geklemmt, und spielt damit auf die direkt für das Publikum erkennbare, weil so oft von ihr in der Show genutzte „Toi, toi, toi!“-Geste an. „Lasst uns also gemeinsam endlich hier und heute aufhören, zu glauben, wir seien so wichtig.“ Der Regisseur fühlt sich im Innersten ertappt, doch sieht erleichtert, wie sich Sicherheitsmänner Ulla Kock am Brink langsam und vorsichtig nähern. Hinter ihm, irgendwo bei der Tonabmischung, sagt jemand: „Das Schlimmste ist ja, dass sie nur so Pseudokluges auf die Reihe bekommt. Wenn sie auf Sendung ist, pseudo-moderiert sie und nun pseudo-philosophiert sie. Sie ist und bleibt stets und ständig pseudo. Nichts von dem, was sie sagt, ist authentisch.“ Der Regisseur dreht sich zur Tonabmischung um, um denjenigen streng anzuschauen, der sowas Blödes sagt, doch bei der Tonabmischung sitzt überhaupt keiner. Nanu?, denkt der Regisseur.
Ulla Kock am Brink sagt noch irgendetwas über unsere Unfähigkeit, voneinander Abschied zu nehmen; über unsere vollkommen vom Alltag losgelöste Bedeutungsmacht, die der Tod seit jeher über uns hat, und dass diese sich doch bitte sehr allmählich vom Acker machen könne, ja, doch, so sagt sie es, „vom Acker machen.“ Und dann hält sie einen kurzen Moment inne. Im Regieraum schauen die Wenigen, die noch geblieben sind, nun allesamt auf den kleinen Vorschaumonitor und diejenigen, die schon länger im Produktionsteam der Show sind, können nun etwas sehen, was ihr das Vertrauen in die U.K.A.B. und in ihren derzeitigen Geisteszustand zumindest teils zurückgeben wird: sie alle im Regieraum sehen nun „ihr Streichen“ – die für Ulla Kock am Brink so typisch gewordene Geste, bei der sie mit ihrer linken, gespreizten Hand einmal kurz, für den normalen Zuschauer unmerklich geschwind über die linke Hüftgegend streicht, als würde sie eine Bügelfalte kurzzeitig geraderaffen oder eine kleine, süße Ameise von ihrem Hosenanzug befördern wollen. In einem Nachgespräch zu einer Aufzeichnung der ersten Staffel, irgendwann 1993 also, sagte sie dem Regieteam, „ihr Streichen“ sei eine von ihr unkontrollierbare Geste, ein kleiner Tic, eine Mikroexpression, ein von der früh verstorbenen Mutter aufgeschnappter Atavismus, den sie seit frühester Kindheit nutze, wenn immer ihr die Situation zu viel werde; wenn sie drohe, abzufallen; wenn etwas allmählich Anzeichen dafür entwickelt, ihr über den Kopf zu wachsen. „Heißt das, die Show ist dir zu stressig?“, hatte ein Regieassistent damals gefragt, und sie hatte ihn beschwichtigend und warmherzig an die Hand gefasst und gesagt: „Nein, alles super, absolut nicht. Ich hab das schon ganz, ganz schnell, auch wenn noch alles total in Ordnung ist. Dann und wann denk ich einfach nur ganz fix, unbewusst, so, dass es kaum meine Gedanken bewusst beschäftigt, dass ja eventuell etwas schiefgehen könnte; dass ich den Faden oder die Fassung verlieren könnte. Das ist überhaupt kein Grund zur Sorge, Tobi, nun wirklich nicht!“ Der Regieassistent namens Tobi war besänftigt, dennoch gab er dem Regisseur weiter, dass er, wann immer er auch „ihr Streichen“ sah, das Tempo der Show ein ganz kleines Bisschen, nur ein My reduzieren solle. Die Regie hatte sich daran gehalten. Viele der von Fernsehzuschauern nun in den folgenden Staffeln bemängelten Momente, in denen der Show scheinbar ein wenig die Luft ausging; in der sie ermüdet herumzappelte wie eine allmählich erstickende Forelle im Gras; in der sie einfach ihre Längen hatte, waren in Wahrheit Resultat „ihres Streichens“. Nun also sahen die alten Hasen „ihr Streichen“ auf dem Vorschaumonitor, auch der hinzu gerufene Chef-Produzent John de Mol, der vollkommen erschüttert im Türrahmen zur Regie steht und auf „ihr Streichen“ mit ehrlichem, beinahe schon väterlichem Mitgefühl und dem Satz „Mensch, Ulla, was tust du denn?“ reagiert. Er wollte nicht, dass diese Szene an die Öffentlichkeit gelangt. Er möchte keine, sich das Maul über das willkommene Opfer Ulla Kock am Brink zerreißenden, schundhaften Boulevard-Zeitungsberichte. Er möchte eine quotenstarke, spannende und unterhaltsame Gameshow für die ganze Familie mit Top-Werbeslots und erstklassiger Zielgruppe produzieren. Er, und diesen ihn nun durchflutenden Gedanken sagt er laut, er „möchte keinen Ärger, [er] möchte keinen Stress, [er] möchte bloß, dass sich das alles aufklärt und man Ulla hilft! Jetzt. Sofort! Pronto!“ Je länger der Satz andauerte, desto lauter wurde de Mol. Doch keiner reagiert.
Die Kandidaten werden zu ihren Garderoben geführt, dort sollen sie verharren, bis entschieden wurde, ob und wie es weitergeht. Eine Kandidatin fragt, ob sie in ihren Spieloutfits bleiben sollen und die Aufnahmeleiterin, die glücklicherweise vor jeder Sendung ein bisschen Baldrian zu sich nimmt, antwortet, dass sie das momentan leider nicht sagen könne, sowas habe sie auch noch nie erlebt, es tue ihr sehr, sehr leid.
Die UKAB macht einen Schritt auf die Kamera. „Jeder von uns kennt es, diesen Moment, in dem wir erstmals vor dem Kurzwellenempfänger unserer Eltern saßen und die hohen, tinnitusähnlichen Radio-Interferenzen aus der Atmosphäre hörten. Wir saßen vom Radio und wussten, wir hörten soeben physikalische Prozesse im Weltall. Nun sitzen Sie, meine Damen und Herren“, und sie schaute verschwörerisch in die Kamera, „vor dem Fernseher, und empfangen die Wellen, die wir im Sendezentrum analog verbreiten. Der Fernseher ist ein Medium – er channelt die uns unsichtbaren Wellen. Der Spiritismus des letzten Jahrhunderts war nicht radikal genug, wir müssen die Toten auf diesem Erdball wieder zu uns holen, indem wir“- in diesem Moment wird die UKAB von den Sicherheitskräften des Studios sanft an den Schultern gefasst. Sie sagen der Moderatorin leise Worte, diese schaut weiterhin ungebrochen in die Kamera. Sie wendet auch während der nun folgenden Geschehnisse den Blick von dem ihr entgegen gereckten, seelenlosen Objektiv der Kamera für keine Sekunde ab. Sobald die Sicherheitskräfte nun beginnen, die UKAB abzuführen – durchaus zart, quasi liebevoll, mit derselben Würde, mit der man seine gebrechliche Großmutter durch einen schönen Garten voller blauer Blumen führen würde -, fallen nach und nach die Studioscheinwerfer aus. Die Publikumsblöcke werden in Dunkel gehüllt. Niemand schreit auf, nur das Summen aus dem Publikum scheint lauter zu werden. Chefproduzent John de Mol betritt das Studio. Der eigentlich auf ihn gerichtet werden sollende Verfolger-Scheinwerfer verfügt ebenfalls über keinen Strom mehr. Er steht im Dunkeln, doch sein Mikrofon, das er in der Hand hält, das funktioniert noch: „Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer“, sagt er in Richtung des Zuschauerblocks. „Wir brechen diese Aufzeichnung an dieser Stelle ab. Frau Kock am Brink wird backstage“ – nun fallen auch die letzten verfügbaren Scheinwerfer aus und die Bühne wird in pechschwarze Kleider aus Schatten gehüllt. De Mol will – davon äußerst erschrocken – nun einen kleinen Scherz in sein Mikrofon sagen, vielleicht etwas wie „Ha, als ginge es hier nicht mit rechten Dingen zu“, doch er kommt nicht dazu, denn er hört, wie sich die mehreren hundert Zuschauer auf den Sitzbänken vor ihm kollektiv erheben und anscheinend langsam, sehr langsam --- ENDE.

3 notes
·
View notes
Photo
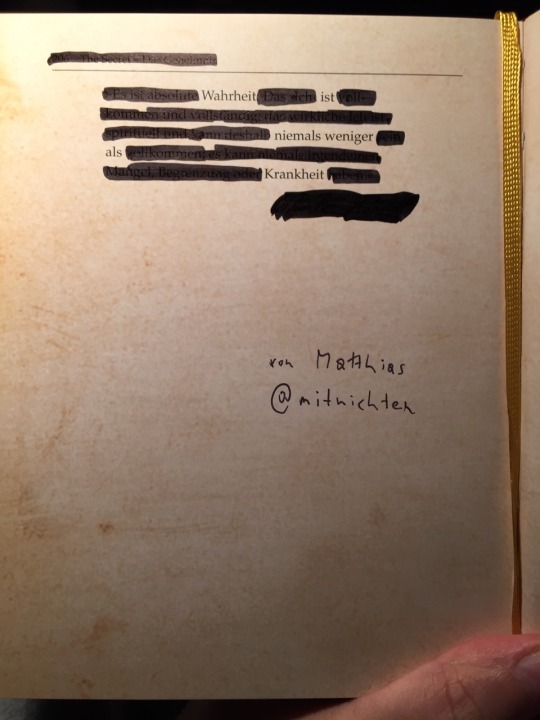
Wahrheit ist niemals weniger als Krankheit.
(Von Matthias @mitnichten auf Twitter, der mir half, weil mir nichts zu der Seite einfiel)
11 notes
·
View notes
Text
Liebesbrief 1955
Auf einer Probe für ein Stück am Dortmunder Schaulspielhaus fiel mir dieser Brief in die Hände. Er muss wohl jahre- und jahrzehntelang als Brief-Attrappe im Requisitenfundus des Theaters gelegen haben. Die Ausstatterin erlaubt mir, ihn mitzunehmen. Eigentlich bin ich nicht der seltsame Typ von Walter-Kempowski-Mensch, der private Postkarten auf Flohmärkten kauft oder sich für Alltagsgeschichte sonderlich interessiert. Aber die paar Sätze, die ich beim ersten Überfliegen las, hatten es in sich. Zarte, brave Schulschreibschrift, hellblaue Tinte, hauchdünnes Butterbrotpapier und sieben eng beschriebene Seiten. Ein Oberstufenschüler namens Eli (oder eine Oberstufenschülerin?) schreibt im Juli 1955 von Kamen ins südlich gelegene Altena im Sauerland. Der Schüler oder junge Lehramtsstudent, das ist ziemliche Auslegungssache, schreibt über den Stress in der Schule oder Uni. Er schreibt über Aischylos und Sartre, über sein bevorstehendes Praktikum und eine Fahrt per Anhalter durchs nächtliche Dortmund der Wirtschaftswunderjahre. Alles garniert mit zum einen wunderschön archaischen 50er Jahre-Jugendslang, zum anderen mit zeitlosen, tumben Grübeleien. Irgendwann während des Briefs, von denen längst nicht alle Passagen Sinn ergeben, wandelt sich der Ton komplett - es handelt sich anscheinend, oho, um einen Liebesbrief. Am Tag vorher haben sie sich erstmals getroffen und wohl auch erstmals im Leben geküsst. Der Autor schreibt ein paar Absätze voller aufrichtigem Liebeskitsch, streift dann und wann gefährlich tiefe, wohl von Sartre entfachte, Sinnkrisen, und endet dann mit düster-zweideutigen, religiös befeuerten Anspielungen auf etwas, was bei diesem Treffen vorgefallen sein muss und wofür sich niemand zu schämen brauche - womit vermutlich Sex gemeint sein wird, aber weiß mans? Nein, das ist ja das Schöne. Ich gebe den Brief hier ungekürzt wieder. Manches ist langweilig, vieles redundant und unverständlich - aber wer bin ich, dass ich da Spannendes und weniger Spannendes hätte bewerten sollen? Was ich nicht lesen konnte, habe ich markiert - ein paar Dinge, die ich rasch via Google habe recherchieren können, habe ich erklärt. Die wichtigsten Fragen bleiben bestehen: Was wurde aus den Beiden? Wurde der Brief von einem Mann oder einer Frau geschrieben - wie alt waren sie? Was ist vorgefallen? Was wurde aus dem sehnsuchtsvoll erträumten Landschulpraktikum im Sauerland? Und wie kam dieser Brief, orginal mit vergilbtem Umschlag und Ludwig Erhard-Briefmarke, in den Requisitenfundus des Theaters Dortmund? Man kann nur raten. Zum Ende steht dort, der Brief solle nicht weitergegeben werden, doch ich glaube, nach fast 60 Jahren, im Zeitalter der Post-Privacy angelangt, ist diese Schweigepflicht wohl erloschen. Und nun, der Brief.
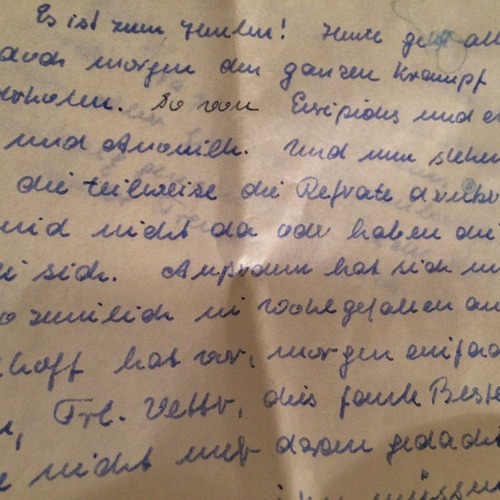
Dortmund, den 25. 7. 55
Es ist zum Heulen! Heute geht alles schief! Wir sollen auch morgen den ganzen Krampf im Wahlfach wiederholen. So von Euripides und Aischylos bis Sartre und Anouilh. Und nun stehen wir da. Die Leute, die teilweise die Referate darüber gehalten haben sind nicht da oder haben die Sachen nicht bei sich. Außerdem hat sich unsere Gruppe so ziemlich in Wohlgefallen aufgelöst. Markus hat vor, morgen einfach nicht zu erscheinen; Margot, das faule Besteck, behauptet, sie hätte nicht mehr daran gedacht und wir hätten sie davon (unterrichten?) müssen! Vor solch einer Unverschämtheit ist mir der Verstand stehen geblieben. Man sollte dem Dörning einfach sagen, dass man mit dem ganzen Krempel allein dasteht. Dörning sollte uns die Protokolle der Stunden rausgeben, aber der behauptet, er hätte sie nicht da, und außerdem hätten wir 14 Tage Zeit gehabt. Da kann man nur sagen: Mahlzeit. Wenn das morgen kein tragisches Ende nimmt, heiße ich Kaspar Hauser!
Die neueste Hiobsbotschaft ist außerdem, dass wir nun doch unser Landschulpraktikum machen müssen (heiliges Durcheinander!) und zwar im September 55 und zwar vom 12.-24.! Nochmals Mahlzeit! Das Landschulpraktikum wird auch noch um 1 Woche verkürzt. Außerdem kommt der Blödsinn dazu, dass die Schulen des Kreises Unna vom 15.-30. Sept. Ferien haben. Was tun, sprach Zeus? Du musst mir jetzt mal einen Gefallen tun, ja, bitte. Erkundige dich bitte mal, wann die Landschulen im Sauerland Ferien haben. Wie wär’s, wenn ich zu dir nach [unleserlich] ging an die [unleserlich]? Ich könnte ja dort bei meinen Verwandten wohnen. Das wäre doch prima, waaa? He, Sie, wäre das nicht wonderful… marvellous? Das wäre an der ganzen Sache das einzig Erfreuliche, d.h., für das mache ich gern 6 Wochen Praktikum! Mensch, dann könntest du abends doch mal kommen, oder ich komme, oder wir treffen uns irgendwo… Einen Augenblick, wir müssen nochmal zu Dörning. –
Zurück, etwas Stoff gekriegt: Weinstock. Naja, lassen wir uns morgen über den aus! Aber gerade eine Freudenbotschaft in Empfang genommen: Seidel hat bestanden! Vor lauter Freude habe ich dem Mann den Weinstock auf den Kopf geknallt, dass es nur so gerumst hat! Du, ich habe mich so gefreut, als wenn es meine eigene Prüfung gewesen wäre. Alle drei Leutchen (?) sind mit (unleserlich) durchgerutscht! Schreibst du Seidel mal?
Sag mal, wie bist du holdes Wesen denn gestern nach Hause gekommen? Hoffentlich hat alles gut geklappt. Ich habe die ganze Zeit ein bitterböses Gewissen gehabt, dass ich abgestreunert bin, ohne dass ich wusste, wie und wann du noch nach Hause gekommen bist. Der Mantel ist übrigens gestern noch „in die Reinigung gegangen“. Ist alles sauber geworden. Heute oder morgen werde ich das gute Stück ausbügeln, zufrieden? Ist übrigens das erste praktische „(unleserlich)“, was ich für dich tue, und was meinst du, wie gern ich das tu! Ich bringe ihn Freitag mit. Capito?
Was meinst du wohl, wie ich gestern nach Hause gekommen bin? Das war noch eine Reise mit Hindernissen. Die gute Freuen (?) nahmen mich also bis Dortmund mit (stellte sich übrigens heraus, dass die gute (unleserlicher Name) mal an der P.H. (Pädagogische Hochschule) in Dortmund studiert hatte, ja, ja, die Welt ist klein) und setzte mich bei Ophoff (ein Hotel an der B1, das 2000 abgerissen wurde) ab. Es war mittlerweile 5 Min. vor 11 geworden. 23.12 Uhr fuhr mein Zug. Die nächste Straßenbahn war erst 23.15 am Bahnhof. Den Weg zu Fuß zu laufen, hatte auch keinen Zweck. Was tun, sprach Zeus zum zweiten Male? Wieder Auto angehalten (nicht schimpfen). Ein eleganter Mercedes brauste heran und – hielt. Die Insassen: 2 Herren, 1 Dame und nicht gerade wenige Bierdüfte. Na, ich dachte, jetzt kommste in des Teufels Küche. Doch ich entwich gnädig jenem Schicksal. Der gute Mann fuhr verhältnismäßig langsam und sicher. (Unleserlich) wollte mich zwar unbedingt zum Glas Bier noch einladen und mich dann auch nach Kamen bringen, aber mir reichte es. Zufällig erzählte der Fahrer, dass er 2 Zimmer an baldige Studenten vermieten wolle. Er gab mir seine Visitenkarte und wer war der Kerl? Prokurist bei einer ziemlich großen Firma in Dortmund, daher auch der elegante Wagen! Wir könnten ja mal miteinander reden. Freitag. Übrigens fällt mir gerade ein, dass ich heute eine Karte von Sohlbach bekam: besetzt. Mahlzeit!
Du, was magst du wohl gestern noch gedacht haben? Es war so grässlich (?), dass wir so schnell auseinander mussten. Oder gab es nichts mehr zu sagen? Nun, auf der einen Seite gab es nichts mehr zu sagen. Das Erleben (?) war zu groß gewesen, als dass man hätte es mit Worten nur feststellen (darstellen?) dürfen. Ach Du, du hast mich gestern unendlich glücklich gemacht. Ich habe es mir zwar alles wundervoll vorstellt, aber nicht so schön. Es war vielleicht nicht das, was einen umwirft, wie du einmal sagtest, wie du dir deinen ersten Kuss vorgestellt hast. Es war anders. Es war natürlich und nichts Besonderes, es war so, als wenn es schon immer so wäre und war doch neu. Ach du, es war keine störende Grenze mehr da. Es war wunderbar. Und wenn ich mal gesagt habe, dass man diesen Bereich (unleserliche Wörter) Liebe trennen müsse und ihm ein gesondertes Dasein zugestehen müsse, so widerrufe ich das hiermit! Es ist genau so ein Teil der Liebe wie jemanden erstmals in die Augen sehen.
Du, ich kann dir nicht sagen, wie es in mir aussieht, es scheint das Glück mich zu zerpressen (?). Womit haben wir Menschen verdient, dass wir soviel Glück empfinden dürfen? Ach du, ich weiß nicht, was ich tun soll. Man wird manchmal wahnsinnig, wenn man an das Erlebte denkt. Geht es dir auch so? Man darf das ein ganzes Leben lang erleben, es ist nicht zu fassen! Ich freue mich wahnsinnig; man glaubt, es gäbe oft keine Mehr mehr. Und jedesmal, wenn ich mit dir zusammen bin, gibt es ein Anders, ein Schöner, ein Mehr und ein Meer von Glück und Liebe. Es tut mir nichts leid, was wir getan haben, aber auch gar nichts. Und ich möchte, dass du auch so denkst. Das heißt nun nicht, dass wir jeder Verantwortung uns entheben können. Nein, der Kampf wird weitergehen bis zum Ende oder Anfang. Nichts geben wir von dem auf, was wir uns vorgenommen haben, hörst du, nichts! Wir dürfen nur nicht daran zerbrechen, wenn wir uns mal „verloren“ haben. Ist unser Vorhaben nicht der Wahnsinn, und trotzdem nehmen wir es auf uns? Aber bei all dem bleiben wir Menschen, die versagen; und es ist auch gut, dass wir versagen, um immer wieder unsere Grenzen einzusehen. Wäre es nicht sogar Hybris, zu glauben, man erreichte alles, was man erreichen wollte? „Wir sind alle mal Sünder und bedürfen der Gnade Gottes,“ heißt es. Und ich glaube, wenn man überhaupt mit Maßstäben (unleserlich) darf, dass diese Übertretung zu den kleinsten Sünden gehört, weil es zum Natürlichsten des Menschenleben gehört. Bitte sei nicht traurig, sei glücklich!
Du, ich freu mich schon wer weiß wie auf Freitag! Ob das wohl mal aufhört, dass man immer beisammen sein möchte!? Ich glaube, nie! Nein, ich WEISS, nie! Kriegst auch beaucoup, beaucoup Küsschen! Darf ich dir morgen den Fahrplan für Freitag schicken? Diesen Brief nicht weitergeben!
Eli
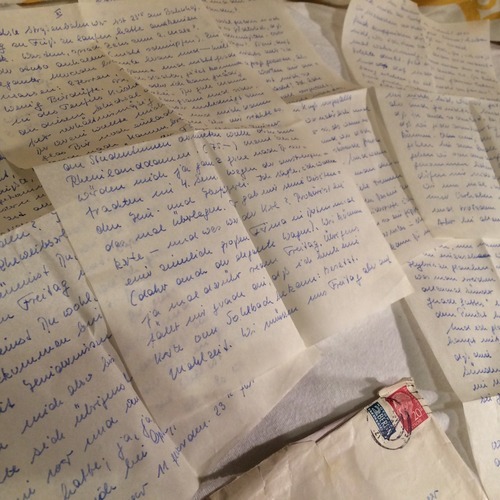
10 notes
·
View notes
Text
Die Hoffnung und die Reue
DIE HOFFNUNG UND DIE REUE - Ein autobiographischer Text über Wuppertal
Von Essen kommend und die S-Bahn nach Wuppertal nehmend, um dort einen alten Freund zu besuchen, dem ich zur Zeit des Abiturs sehr nahe stand, dessen Lebenslauf sich inzwischen jedoch so sehr von meinem entfernt hat, das ich ihn dann und wann allenfalls noch am Horizont erahnen kann, wenn ich durch seine Facebook-Beiträge sehe, dass er sich zurzeit auch in meiner Heimat, dem Westmünsterland befindet, und ich kann nur vermuten, dass unsere Entfremdung an dem liegt, was ich jetzt erzählen werde, in jener S-Bahn also hänge ich trübsinnigen Gedanken nach, während ich trotz werktäglichem Nachmittag in einem außer mir und einer schlafenden Frau vollkommen leeren Waggon sitze und den Regenfäden zuschaue, die die Scheibe hinunter rinnen und vor mir in vollkommener Monotonie auf das sich auftuende Bergische Land hinuntergehen. Die Baumkronen werden von dem nun aufkommenden Wind sacht und elegisch hin und her gewogen, die Straßen sind ungewöhnlich leer und es wird vor dem Zugfenster so düster, als würde es Abend werden. Das angenehm leise Summen und Rattern des Zuges, dass mich oft in eine wunderschöne, schläfrige Stimmung versetzen kann, betont jetzt vielmehr die Stille, die in der Bahn herrscht, und lässt mich allmählich nervös werden. Meine Kopfhörer liegen untätig auf dem Sitz neben mir, da auf der Höhe Velbert-Rosenhügel der Akku meines iPods versiegte, mit dem ich in den letzten Minuten noch ungewollt passende Musik von The Caretaker hörte, einem zwischen Konzeptkunst und Musik hin und her diffundierendem Projekt, bei dem ein Brite besonders eindringliche, schaurige oder melancholische Momente alter, durch Knistern, Rauschen und andere Zeichen der Zeit korrumpierter Schellack- und Vinylschallplatten leicht bearbeitet und loopt, sie also hintereinander stellt, minutenlang eine Melodie wiederholt, bis sie entweder wahnsinnig macht oder sich als nostalgisches Hintergrundrauschen in den Kopf fügt, nur um dann plötzlich und aus dem Nichts in einem wahrhaftig angsteinflößenden Moment zu verstummen.
Die erste Zugfahrt nach Wuppertal, die ich im Februar 2014 kurz nach meinem 21. Geburtstag unternahm, ebenfalls mit der gleichen S-Bahn aus Essen und ebenfalls mit dem Ziel, meinen alten Freund in seiner neuen Heimat besuchen zu kommen, führte bei mir seltsamerweise zu der gleichen emotionalen Zerrüttung, dies allerdings nicht aufgrund des Wetters, einer unbehaglichen leeren Zugkabine oder dem Hören obskurer, postmoderner Gruselmusik. Ich hatte damals, nachdem ich den Erzählband einige Wochen zuvor zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, die Erzählung „Paul Bereyter“ von W.G. Sebald gelesen, was für mich eine Art Erweckungserlebnis war, da dies sicherlich die sowohl stilistisch meisterlichste wie auch traurigste Erzählung war, die ich bis dato je gelesen hatte, und so kam ich dementsprechend zerrüttet in Wuppertal an. Als ich bei bestem Sonnenschein auf dem wirklich überraschend tristen Gleis 11 des Hauptbahnhofs ankam und die nur schummrig beleuchtete, sich bereits in Renovatur befindliche Schräge hinab zur Eingangshalle hinunterschritt, merkte ich überhaupt erst, dass ich Tränen in den Augen hatte – ein Umstand, den ich beim Lesen und auch bei den darauffolgenden Gedanken und Aus-dem-Fenster-Schauereien nicht bemerkt hatte. Mein Freund, der in der Eingangshalle nahe eines kleinen, schäbig anmutenden Kiosks auf mich wartete, nahm mich kurz in den Arm und fragte mich, ob etwas mit mir los sei, ich Heuschnupfen oder was geraucht hätte. Ich weiß nicht mehr, was ich damals antwortete, da ich den Blick des Kiosk-Betreibers auf mir spürte und als ich mich ihm zuwand, sah ich, dass er mich tatsächlich anstarrte und zwar mit einem Blick, aus dem sowohl jahrzehntelang gereifte Langeweile und Verdrießlichkeit, aber auch tiefsitzende und vermutlich ganz und gar ernstgemeinte Verachtung sprachen. Der traurigste Mensch dieses Universums, dachte ich, vielleicht ist er es nicht, aber er sieht ganz bestimmt so oder ganz, ganz ähnlich aus. Nach dieser alles andere als erquicklichen Ankunft in Wuppertal schritten wir durch die Innenstadt zur Schwebebahn und er meinte, dass ihn die Gebirgigkeit der Umgebung, die Nähe zur wild erscheinenden Umwelt sowie die hügeligen Straßen („In Wuppertal zu fahren ist ein stetes Auf und Ab“, sagte er) stets an San Francisco erinnern würden, wohingegen ihn die desolate Situation der Stadt, der unbarmherzig vorangepeitschte Kulturabbau wie auch die sich mit erschreckend hohem Tempo ausbreitende Tristesse des Stadtbildes eher an Detroit erinnern würden. Eine Mischung aus beidem ist es bestimmt, sagte ich – immer noch in melancholischen Gedankenzyklen befangen, die Sebald in mir ausgelöst hatte –, der amerikanische Traum und der Albtraum, die Hoffnung und die Reue, irgendwo hier im Bergischen Land, an der Peripherie Nordrhein-Westfalens. Der Freund sah mich an, und mir war direkt peinlich, was ich da so vor mich geredet hatte.
Vieles wäre über den Abend zu erzählen, wie wir beispielsweise damals ein unverschlossen herumstehendes Citybike schnappten und bloß im T-Shirt die leeren, gebirgigen Straßen, deren Namen ich längst schon wieder vergessen habe, hinuntersausten – abwechselnd auf dem Sattel und dem Gepäckträger – und ich dabei lachte wie ein Schwimmer, der nach einem langen Tauchgang unten bei den düsteren Korallen und Fischen zurück an das Grünblaue der Wasseroberfläche empor stieß. Später saßen wir dann in seiner wunderschönen Dachstuhlwohnung des Hauses, wir hörten das Unplugged-Konzert von Bob Dylan, dass er mir zum Geburtstag auf CD geschenkt hatte, und fast – aber auch nur fast – wäre an diesem Abend noch etwas zwischen uns geschehen, dass in all den Jahren zuvor nie geschah und nein, nicht mal denkbar gewesen war. Doch es geschah nicht, und in dem Moment, in dem wir beide das klarmachten – es bedurfte dazu nicht vieler Worte – spürte ich eine große, gigantische Welle der Enttäuschung und dann der Erleichterung mich überschwappen. Kurz zuvor hatte er ein Polaroid von mir gemacht. Alle Gäste seiner Wohnung wurden so photographiert und an Ort und

Stelle an einen ebenholzschwarzen Dachbalken aufgehängt. Ich kann mir dieses Bild – ich habe es später betrunken selber nochmal abgelichtet -, kaum mehr anschauen. Ich kann meine zur Schau gestellte Unbeholfenheit, die Hilflosigkeit mit der Bierflasche, das ungestüm blöde Lächeln, als wäre ich just aus einem Tiefschlaf aufgeweckt worden, die gekrümmte Rückenhaltung vor den Beatles-Platten an der Wand, nicht ertragen. Ich übernachte in seinem Bett, er liegt neben mir und ich höre sein Atmen. Ich weiß, dass ich in der Nacht irgendetwas träumte, aber kann mich heute an nichts mehr erinnern.
Auf der Rückfahrt lese ich „Ambros Adelwarth“, die nächste Geschichte im Erzählband von Sebald. Immer mal wieder schaue ich an den Haltestationen der Wuppertaler Vororte nach draußen, sehe die teils brachliegende, teils noch emsig vor sich hinschlotende Industrie, die sich in die Berge vor der Stadt zurückgezogen hatte, um dort ihrem Tagwerk zu frönen. Kurz vor der Ankunft in Dortmund hatte ich die Geschichte fertiggelesen und ich schrieb auf einem

ausgerissenen Ausschnitt eines Wuppertaler Anzeigenblattes, den er mir mitgegeben hatte, da wir beide eine Vorliebe für am Niederrhein oft vorkommende, provinziell-abenteuerliche Ortsnamen wie Hönnepel-Niedermörmter teilten, ein paar Wörter hin, eigentlich gar nichts Wirkliches, irgendetwas über einen Strand und ich erinnere mich nur noch an die ersten zwei Zeilen – das Gedicht ist verloren, da ich das Blatt, auf dem ich es schrieb aus der Zeitung trennte, es später aber gedankenverloren dann doch in der S-Bahn liegenließ. Ich schrieb über das Meer:
„Wellen wie ein Kanon, Gischt wie Ektoplasma, Strandkörbe als Schrein / der vom Salz geküsste Schlamm der Küste blutet in die See hinein“.
Am Dortmunder Bahnhof aß ich dann ein Brötchen und ging nach Hause.
4 notes
·
View notes
Text
Die Angestellten
Geschrieben mit leicht erhöhter Temperatur, einem Kater vom Theaterabend zuvor und unaufhörlich auf die Fensterschreibe prasselndem Regen
Durch den Nebel kämpfen sich die Angestellten. Sie sind spät dran, aber das ist ja nicht weiter schlimm, schließlich geht die Uhr im Büro fünf Minuten nach. Eigentlich müssen alle um viertel vor neun da sein, doch jetzt ist es schon 8.49 Uhr und dennoch sind sie komplett pünktlich. Alle wissen, dass die Uhr fünf Minuten nachgeht, doch wird das dem Vorgesetzten gesagt? Natürlich nicht. Im Treppenhaus wird geredet. Sonores Brummen, helles Lachen, griesgrämiges Murmeln, müdes Plaudern hängt in der von Frischluft und Fensterbankpflanzengeruch geschwängerten Luft. Manche nehmen zwei Stufen auf einmal, die meisten laufen träge und Stufe für Stufe hinauf, drei Stockwerke lang, für die Körperlich-Beeinträchtigten und die faulen Säcke (größtenteils Buchhaltung, übrigens) gibt es einen Aufzug, aber in ihm riecht es modrig, er rattert und eines Morgens fanden Angestellte mal eine tote Spitzmaus drin. Seitdem ist der Fahrstuhl von Schindler, Top-Marke eigentlich, ein bisschen in Verruf geraten. Auf dem Weg zwischen dem zweiten und dritten Stockwerk verstummen die Gespräche ein wenig. Dort enden meist die Smalltalk-Gespräche von draußen (der Nebel, der späte Bus, die vollen Straßen) und werden nach der so entstehenden kurzen Gesprächspause durch bürointerne Konversationsthemen (Müdigkeit, Lohnabrechnung, die scheißenblöde Software) ersetzt. Wem das zu öde ist, fragt: „Na, gestern auch Aktenzeichen XY gesehen?“ Oder „Alarm für Cobra 11“. Keiner hat’s gesehen, aber die Tagesthemen, die schon, das ist meist der gemeinsame Nenner und dann wird erstmal geredet, über Nachrichten, Nachrichten vom Tage. Der Tag ist noch nicht mal neun Stunden alt und schon gibt es Nachrichten von ihm. Nachrichten, die ihm persönlich nichts angehen. Von den 28 Angestellten im Treppenhaus tragen 23 ein hellblaues Hemd und eine dunkle Hose.
Oben angekommen werden erstmal die Tickets durch die Stechuhren gezerrt und geschleift, es piept blöde, und dann ab in die einzelnen Büros, alle auf einer Etage. Die PCs werden hochgefahren, die Kaffeemaschinen entkalkt, die E-Mails gecheckt. Eine Rundmail vom Chef, das mit der Stechuhr sei jetzt behoben, scheiße, denken die Angestellten. Von nun an pünktlich sein. Einer der Angestellten hat einen prima Witz dazu auf Lager, doch in dem Moment, wo er die Pointe raushauen will, erscheint eine unerwartete Fehlermeldung am PC, davon ist er abgelenkt und als er wieder zum zweiten Mal zum großen Pointen-Inferno mit Schmackes ansetzt, fällt ihm auf, dass er die Pointe vergessen hat, nicht so schlimm, denkt er, mir hat eh keiner zugehört. Die Fehlermeldung beunruhigt ihn, er telefoniert mit dem technischen Support, der elitär und abgeschottet eine Etage höher residiert – in zwar muffigen, doch dafür großräumigen Büroräumen. Der Mann vom technischen Support ist schlecht gelaunt, er kann sich die Fehlermeldung auch nicht erklären, wäre es denn in Ordnung, falls Sie den PC neustarten würden? Dann mal gucken, ob’s klappt und falls es nicht klappt – das sagt er bloß hypothetisch zur Beruhigung des absolut unwissenden und unfähigen Angestellten; es klappt nämlich immer -, dann bitte nochmal anrufen. Ich drück Ihnen die Daumen, tschüss. Schade, denkt der Angestellte, während er die komplett harmlose und unbedeutende Fehlermeldung wegklickt und seine Software startet. Letztens ging beim technischen Support eine sehr wohlklingende weibliche Stimme dran, nicht älter als dreißig, aber was will man machen.
Es kopieren die Kopierer, es lochen die Locher, es tackern die Tacker, es stellen sich die Angestellten an: zu heißer Kaffee, zu kalter Kaffee, mieses Wetter, Benzin so teuer, der nervige Kunde, scheißenblöde Software! Zwischendurch gehen sie getrennt voneinander auf die Toilette, jeder Zweite wäscht sich die Hände. Dann und wann schauen sie aus dem Fenster oder gießen den Zimmerkaktus. Immer mal wieder fühlen ein paar von ihnen vorm PC eine kleine Traurigkeit oder ein bisschen Freude, und dann schauen sie hektisch im Kalender nach, ob es nicht noch irgendwas abzuarbeiten gibt, damit man nicht soviel nachdenken muss. Es wird auf Spiegel Online rumgehangen. Es wird auf Facebook geguckt, geschrieben und basisdemokratisch abgestimmt. Der Angestellte aus der Buchhandlung kann innerhalb von zwanzig Sekunden 210mal mit der Maus klicken, der aus dem Controlling 214mal. Das muss erstmal auf die Pinnwand – auf die von Facebook und auf die „Freizeit"-Pinnwand vom Büro, direkt neben der „Aufträge & Ideen“-Pinnwand. Auf den dritten Platz trägt sich ein Angestellter aus dem Kundensupport ein, 201mal. Außer dem Klickspiel hängt absolut gar nichts auf der "Freizeit"-Pinnwand des Büros. Eine Buchhalterin geht durchs Büro und sammelt für ein Abschiedsgeschenk für eine bald in Rente gehende Kollegin. Jeder gibt fünf Euro und sich Mühe, dabei jovial zu wirken.
Währenddessen findet der Angestellte mit der unbedeutenden Fehlermeldung bei Facebook heraus, welches Promipaar sich getrennt hat. Er kommentiert: „sorry leute aber das war ja auch wohl eine frage der zeit! Die haben in den letzten monaten kaum noch was zusammen gemacht, waren nie mehr gemeinsam irgendwo zu sehen. wünsche den beiden alles gute!!“ Danach guckt er das neue Musikvideo seines Lieblingssängers und dann kommt der Abteilungsleiter herein, vergibt einen Auftrag an den armen Kerl neben ihm und verlässt das Büro wie eine unheilvolle Rauchschwade aus den Eingeweiden eines brennenden Gummireifens. „Toller Vergleich!“, sagt der Angestellte, woraufhin sich der arme Kerl neben ihm sich zu ihm umdreht und „Hm?“ fragt, woraufhin der Angestellte sich schleunigst beeilen muss, „Ach, nichts“ zu sagen, denn sonst wirkt er seltsam.
2 notes
·
View notes
Text
Viel, viel schneller
Viel, viel schneller - Ein Nachmittag neben Monstertrucks
(Die meisten Namen wurden geändert.)
Ich stehe in der Warteschlange zum "Monster Jump", dem laut Eigendarstellung größten Monstertruck-Event Europas. Für eine Lokalzeitung soll ich ein paar Fotos schießen und 50-60 Zeilen schreiben. Kleiner Artikel, denn das Event sei ja schon "irgendwie ganz schön stumpfsinnig." Den ganzen Tag über hatte es geregnet, jetzt brechen die grauen Wolken ein wenig auf, es wird schwül und diesig. 14 Grad, sagt eine Temperaturanzeige am naheliegenden Heimwerkercenter. Aus einem Lautsprecher dröhnt Rummelplatz-Musik. Die überwiegende Mehrheit in der Warteschlange sind Männer im Alter zwischen 20 und 40, sie sind hier zahlenmäßig sogar den Jungs mit Auto-T-Shirt überlegen. Auf dem Kassenhäuschen ist ein Sensenmann im violett-gelben Hiphop-Shirt abgebildet. Vom Parkplatz des ehemaligen Möbelhauses, dem place where the magic happens, hallt eine Lautsprecherstimme wieder. "Sitzplatz-Tickets bitte auf die Tribünen, Stehplatz-Tickets an die Gatter. Halten Sie Ihre Eintrittskarte bitte die gesamte Veranstaltung lang fest", ruft die Stimme, glaube ich. Ein Sitzplatz für ein Kind kostet 25 Euro, für einen Erwachsenen fünf Euro mehr. Viele gehen empört, andere eilen schnell zum nächsten Geldautomaten. Eine Mutter, die ihr braunes Haar in eine 80er-Lockenfrisur verwandelt hat, sagt mir, sie sei schon dreimal bei der Show gewesen und die hohen Preise hätten sie noch nie gestört. "Das ist halt der Preis, den mal für so'ne Show zahlen muss."
Ich klettere halbwegs elegant über das Blechgitter und spreche mit Freddy Bossler, gebürtig aus Indianapolis, seit 1969 Stuntfahrer. Bevor er mir die Hand gibt, wischt er sie am Hintern ab. Er hat einen leicht ergrauten Oberlippenbart, eine ölverschmierte rote Opel-Kappe auf, und eine schmutzig-gelbbraune, ebenfalls ölverschmierte Haut. Der Moderator wird später zur Menge rufen, dieser Mann strahle Erfahrung aus. "Wir waren damals Hochseiltänzer", sagt er mir, "und Ende der 60er kam dann der Stunt-Trend aus den USA groß in Mode. Sie wissen schon, die ganzen alten Helden", und er rattert verschiedenste Namen auf, von denen ich mir nur Steve McQueen merken kann. "Wir saßen hier im Rheinland und dachten uns, was die können, können wir schon lange. Ich wurde dann Helldriver, und seit 1978 fahre ich Monstertrucks." Er sagt diesen Satz wie andere davon sprechen, dass sie zuerst eine Ausbildung gemacht und seit 1998 am Bankschalter arbeiten würden. Langweilig wurde das aber nie, meint er, öffentliche Auftritte waren von jeher sein Traum. "Man sieht die strahlenden Kinderaugen, die faszinierten Mütter, die fachsimpelnden Väter", plaudert er, "und fühlt sich in dem Moment einfach wie ein Star." Man merkt, dass er diesen Satz auswendig kann. Über die Jahrzehnte hinweg seien Monstertrucks ein Riesengeschäft. "Die Zuschauerzahlen sind konstant", meint er und blickt auf die größtenteils leeren Ränge vor uns. "Nur heute ist das echt miese Resonanz." Er spuckt aus. "Wir hatten heute halt echt Pech mitm Wetter." Ich sage ihm, dass viele in der Warteschlange den Preis zu hoch fänden. Er sieht mich ernsthaft überrascht an. "Ach. Echt?"
Der Moderator des Events, eine große Lederjacke trägt den Aufdruck PIT BULL, tupft sich mit einer schon leicht zerschlissenen USA-Flagge den Schweiß von der Stirn. „Wir haben bis zur letzten Sekunde mit Wetter-Experten gesprochen, uns intern beraten und immer wieder fragend zu den Regenwolken heraufgeblickt“, dröhnt seine Stimme aus den Lautsprechern und er klingt, als würde er es sich selbst glauben. „Denn wir wollten auf jeden Fall das Monstertruck Jump-Event heute Nachmittag in G. stattfinden lassen!“ Ein paar Leute klatschen. Direkt neben mir sattelt ein junger, durchtrainierter Fahrer namens Paul sein Motorrad. Das Herzkettchen um seinen Hals stopft er sich unter den Helm. Er fährt mit seinem Motorrad ein wenig über den leeren Platz, legt ein paar Wheelies ein und lässt es generell ordentlich knattern. Nach seinem Warm-Up (PIT BULL: „Paul, einer unseren jungen Wilden demonstrierte uns eindringlich seinen langen Bremsweg!“) steigt er vom Motorrad, grinst mich an und sagt: „Geiler Scheiß, hm?“

Freddy und seine Kollegen betreten derweil ihre Stuntautos, springen über Holzrampen, machen wagemutigen Wendungen oder fahren schnell im Kreis herum. PIT BULL ruft: „Jetzt muss alles ganz schnell gehen“, warum auch immer. Viel Struktur lässt sich nämlich nicht erkennen, doch PIT BULL ist bestens gelaunt: „Die Knautschzone in diesen Autos geht gleich null“, ruft er. „Verletzungen, schwere innere Blutungen, Knochenbrüche oder höchst gefährliche Prellungen, die sind hier einfach vorprogrammiert.“ „Die Akteure sind geradezu verantwortungslos wenig geschützt.“ Seine Kommentare werden immer austauschbarer. So wirklich Stimmung will jedoch weiterhin nicht aufkommen. Freddy Bossler bremst während einer Runde kurz vor mir ab und ruft durch das Fenster, „Schön Fotos machen!“ PIT BULL ist inzwischen dazu übergegangen, seine Lieblingsfilme der Reihe „Herbie, der Käfer“ aufzuzählen.
Nachdem die Autos genug Tricks aufgezählt haben, dürfen Zuschauer aus dem Publikum in die Autos einsteigen. Allerdings nur Mädchen im Alter zwischen 16 und 30. Es dauert einige Zeit, bis sie genug Freiwillige zusammenhaben. Freddy drückt auf das Gaspedal, sein Auto heult auf und er rast mit den Mädchen Richtung Ausgang, bis PIT BULL ruft: „Typisch Freddy! Will mit den Mädchen direkt wieder in die Kiste!“ Das Publikum lacht laut und Freddy legt nach dem Abspulen des Gags brav wieder den Rückwärtsgang ein, um ebenfalls mit dem Wagen einmal von einer Rampe zu springen. Sein Kumpel würgt währenddessen sein Auto ab. PIT BULL ruft ins Mikrofon: „Das kommt davon, wenn die Frauen beim Fahren immer schmusen und küssen wollen.“ Wieder Gelächter. PIT BULL fummelt sich seine US-Flagge aus der Hosentasche und tupft sich ab.

„Das ist hier Wahnsinn. Das ist einfach nur spektakulär und leichtsinnig“, ruft PIT BULL, bevor es nach gut 70 Minuten in die Pause geht. Das Publikum murrt ein wenig, weil es bisher weder Spektakuläres und Leichtsinniges gesehen hat. „Keine Bange, backstage bereiten wir die Monstertrucks bereits vor“, was nicht stimmt, da sie für jedermann sichtbar hinten einsam auf dem Parkplatz stehen. „Holen Sie sich Popcorn! Essen Sie eine Bratwurst“, befiehlt PIT BULL. Eine Popcorntüte kostet sechs Ocken. Ich habe für meinen Artikel alle Infos und Fotos zusammen, die ich brauche und haue ab. Auf dem Weg zurück zum Auto höre ich noch, wie die Stimme von PIT BULL über den Platz weht: „Bitte vorm Popcornstand eine Reihe bilden. Es geht dann alles viel, viel schneller!“
3 notes
·
View notes
Note
Ich würde mich sehr über 5 Buchempfehlungen von dir freuen! :) Bitte
W.G. Sebald "Die Ringe des Saturn" oder "Die Ausgewanderten" oder "Austerlitz"Don deLillo "White Noise"David Foster Wallace "Unendlicher Spaß"
Georg Büchner "Lenz"
Roberto Bolano "2666"
0 notes